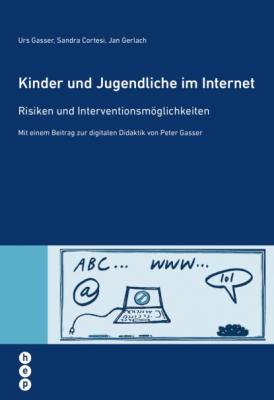ТОП просматриваемых книг сайта:
Kinder und Jugendliche im Internet. Jan Michael Gerlach
Читать онлайн.Название Kinder und Jugendliche im Internet
Год выпуска 0
isbn 9783039059072
Автор произведения Jan Michael Gerlach
Жанр Документальная литература
Издательство Bookwire
Schlussbemerkung
Zweifellos verändern Computer, Internet, Facebook & Co. unseren Alltag, unsere Kommunikation, unseren Beruf und unsere Köpfe. Heranwachsende bzw. die Digital Natives sind davon massiv betroffen und dabei nicht nur den technologischen Segnungen, sondern auch Verführungen ausgesetzt.51 Die Hoffnung, digitale Phänomene mit gelehrter Ignoranz und Ablehnung52 oder mit Regulierung und Verboten in den Griff zu bekommen, ist relativ minim. Uns bleibt nichts anderes, als zwischen blinder Begeisterung und überheblicher Ablehnung zu erforschen und zu überlegen, wohin sich der junge »homo digitaliensis« entwickelt und wie wir als Lehrende und Erziehende diese Entwicklung unterstützen und begleiten können.53 Der Didaktik sind dabei enge Grenzen gesetzt, weil ausserschulische Akteure, Medienschaffende und -anbieter, die Inhalte (z. B. Apps) anbieten, Werte setzen und die Nutzung der neuen Medien informell didaktisieren.
Politiker, Gesetzgeber, Erziehende und Lehrende, aber auch Produzenten und Distribuenten – und nicht zuletzt die Forscher-Community können sich der Verantwortung nicht entziehen, sich mit der neuen Bildungsmacht rezeptiv und mitgestaltend auseinanderzusetzen. Diesem Anliegen will das vorliegende Buch dienen.
KAPITEL I
Grundlagen
1. Ausgangslage
Das Internet hat sich zu einem Multifunktionsmedium entwickelt, das sowohl traditionelle Formen wie Text, Video und Audio miteinander verknüpft, aber insbesondere auch neue Kommunikationsformen ermöglicht und Interaktionsräume eröffnet. Die aktuellen Entwicklungen des Internets sind indes nicht nur technischer Natur; ebenso bedeutsam ist, dass digitale Technologien durch eine zunehmende Einbindung in den Alltag der Menschen gekennzeichnet sind, wie neuere Mediennutzungsstatistiken namentlich aus Amerika und Europa eindrucksvoll belegen. Dabei entstehen neue Gewohnheiten in der Mediennutzung und wichtige soziale Normen, welche die Informations- und Kommunikationsprozesse lenken; diese werden verändert oder hinterfragt. Die zunehmende Zeit, die der Mensch online verbringt, aber auch die qualitativ steigende Bedeutung des Mediums Internet im Alltagsleben bieten Anlass, die mit den vielfältigen Nutzungsarten verbundenen Chancen und Risiken zu analysieren und gegenseitig ins Verhältnis zu setzen. Dabei hat vor allem die zunehmende Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen dazu geführt, dass Erwachsene, Bildungsinstitutionen und Politiker sich mit diesem Thema stärker auseinandersetzen.
In Gesprächen mit Eltern ist der erste angesprochene Problemkreis, wenn es um die Internetnutzung ihrer Kinder geht, regelmässig die Frage der Sicherheit – im Sinne der physischen und psychischen Integrität online. Aber auch Lehrpersonen, Gesetzeshüter und Politikerinnen sind zunehmend um die digitalen Sicherheitsrisiken besorgt. Die Sorge gründet in der (empirisch allerdings nicht fundierten) Annahme, dass ein mediales Umfeld, das Interaktionen mit einem mithin unbekannten Gegenüber ermöglicht, weniger sicher ist als traditionelle Kommunikationsräume, die nicht durch Anonymität gekennzeichnet sind. Während hinsichtlich Problemlage in der breiten Öffentlichkeit weitherum Einigkeit herrscht, trennen sich die Meinungen, wenn es um die Frage wirksamer Gegenmassnahmen geht. Auf der einen Seite wird etwa die Meinung vertreten, Kindern und Jugendlichen soll ein sicherer Umgang mit neuen Medien beigebracht werden – etwa im Rahmen der Medienerziehung in der Schule –, während andere Stimmen argumentieren, dass der Zugang zum Internet oder mindestens gewisse Anwendungen wie etwa soziale Netzwerke eingeschränkt oder gar verboten werden sollten. Die letztgenannte, auf Restriktion angelegte Reaktionsform findet zunehmend in den USA Verbreitung, wo Schulen manche unter Kindern und Jugendlichen populäre Anwendungen blockieren und die Eltern immer öfters Filterungs- und Trackingmethoden verwenden, um die Internetnutzung ihrer Kinder zu überwachen. Während manche dieser Interventionsmöglichkeiten in bestimmten Kontexten und für bestimmte Altersklassen sinnvoll sein können und sicherlich die meisten davon gut gemeint sind, sind sie mehrheitlich angstgetrieben statt datenbasiert und werfen eine Vielzahl neuer Fragen auf, etwa hinsichtlich der Informationsfreiheitsrechte und des Privatsphärenschutzes der Kinder und Jugendlichen. Hinzu kommt, dass die Interventionen oft mehr aus der Sicht der Erwachsenen sinnvoll sind, dabei aber auf geringe Akzeptanz seitens der Kinder und Jugendlichen stossen, was regelmässig zur Umgehung der Schutzmassnahmen führt.
Obwohl im Rahmen der öffentlichen Diskussion und mit Blick auf Politikgestaltung allgemeine Aussagen hinsichtlich der Medien- und Technologienutzung von Kindern und Jugendlichen unvermeidbar und wesensimmanent sind, ist es wichtig, zu verstehen, dass nicht alle jungen Menschen digitale Medien in identischer Weise nutzen.54 Zunächst ist festzuhalten, dass nicht für alle der Zugang zum Internet gleichermassen gewährleistet ist. Gemäss der JAMES-Studie 2010 geben 95 % der Befragten an, im Haushalt Zugang zum Internet zu haben,55 wobei drei Viertel über einen eigenen Computer mit Internetzugang verfügen.56 Wiewohl diese Zahlen absolut gesehen hoch sind und der Trend ermutigend ist (zum Vergleich: laut einer Befragung von SWITCH unter 575 Schweizer Jugendlichen im Alter von 6 bis 20 Jahren, hatten noch im Jahr 2009 lediglich 87 % die Möglichkeit, das Internet zu Hause zu nutzen, wobei 62 % auf einen eigenen Computer mit Internet zurückgreifen konnten),57 zeigen Untersuchungen, dass Jugendliche aus Familien mit tieferem soziökonomischem Status höhere Zugangsschranken haben als die bessergestellte Vergleichsgruppe.58 Dies hat Folgen: Jugendliche mit fehlendem oder eingeschränktem Zugang zum Internet erhalten nicht die gleichen Teilnahmechancen. Insbesondere reduzieren sich für sie die Möglichkeiten, sich die durch Nutzung und Peer-Learning vermittelten technischen und sozialen Fähigkeiten anzueignen. Daraus können sich zum Beispiel Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion online oder im Umgang mit unzuverlässigen Informationen und anderen vermeidbaren Risikosituationen ergeben.
Die Möglichkeit des Zugangs alleine bedeutet indes noch nicht, gleichsam automatisch auch erfahren im Internetumgang zu sein.59 Auch die Zugangsbedingungen sind in den Blick zu nehmen. Gewisse Ungleichheiten hinsichtlich Zugangsbedingungen, die sich ihrerseits auf den Erwerb von Medienkompetenz auswirken, sind dabei gleichsam »hausgemacht«. Beispielsweise ist es in gewissen Ländern nicht unüblich, dass der Zugang zu bestimmten Anwendungen oder Webseiten an Schulen eingeschränkt wird und damit jene Kinder und Jugendliche, die zu Hause über keinen Internetzugang verfügen, im Umgang mit solchen Anwendungen einen Nachteil gegenüber der privilegierten Vergleichsgruppe erleiden. Sowohl theoretische Arbeiten als auch empirische Studien belegen (Henry Jenkins und Eszter Hargittai60), dass es einen wesentlichen Unterschied im Umgang mit Gefahren und Risiken gibt zwischen Jugendlichen mit fortgeschrittenen Fähigkeiten und solchen ohne diese Fähigkeiten.
Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor ist die Zeit, die Kinder und Jugendliche im Internet und mit neuen Medien verbringen. Eine schweizerische Studie aus dem Jahre 2007 belegt, dass es zu einer starken Zunahme des Computerkonsums unter Jugendlichen gekommen ist.61 Nach einer neueren Studie von 2010 sind 89 % der 12- bis 19-Jährigen täglich oder mehrmals pro Woche im Internet.62 Dieser Wert ist signifikant höher als die 47 % der 6- bis 20-Jährigen, die 2009 täglich im Internet waren.63 Dieser Trend wird auch durch Statistiken aus Deutschland unterstützt, wo das Internet bei Jugendlichen das Fernsehen als Leitmedium überholt hat. Gemäss der ARD/ZDF-Onlinestudie 2011 verbringen 14- bis 19-Jährige im Durchschnitt 125 Minuten pro Tag im Internet und 114 Minuten vor dem Fernseher (2009 waren es sogar 123 Minuten im Netz und 97 Minuten Fernsehen).64 Diese eindrücklichen Zahlen spiegeln sich auch in der subjektiven Einschätzung