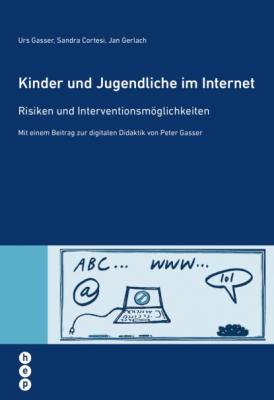ТОП просматриваемых книг сайта:
Kinder und Jugendliche im Internet. Jan Michael Gerlach
Читать онлайн.Название Kinder und Jugendliche im Internet
Год выпуска 0
isbn 9783039059072
Автор произведения Jan Michael Gerlach
Жанр Документальная литература
Издательство Bookwire
Bereits vor dem Hintergrund dieser Statistiken wird deutlich, dass dem Dialog zwischen Eltern und Kindern sowie zwischen Kindern bzw. Jugendlichen und Lehrpersonen eine grosse Bedeutung zukommt, wenn es um die eingangs erwähnten, mit der Internetnutzung verbundenen Risiken geht. Eine Zürcher Studie zeigt dabei den besorgniserregenden Trend an, dass die gemeinsamen Aktivitäten Jugendlicher mit den Eltern in den letzten Jahren deutlich abgenommen haben.68 Die Autoren der Studie schliessen daraus, dass Jugendliche heute nicht nur den Computer stärker nutzen als früher, sondern sich gleichzeitig von den Eltern distanzieren.69 Auch Untersuchungen aus den USA deuten darauf hin, dass der Einfluss der Eltern auf den Mediengebrauch der Jugendlichen vermutlich eher geringer ist als noch vor einigen Jahren, womit die Schulen einen immer wichtiger werdenden Einflussfaktor darstellen dürften. Eine breit angelegte europäische Studie stützt diese Vermutung, indem sie feststellt, dass ein Drittel der befragten 9- bis 16-Jährigen manchmal ignorieren, was ihre Eltern zur Internetnutzung sagen.70 Laut derselben Studie haben 58 % der Befragten angegeben, ihre Lehrpersonen hätten ihnen bereits einmal geholfen, etwas im Internet zu finden oder zu erledigen.71
Aus der Optik der Schulen und Bildungsinstitutionen ist es folglich zunehmend bedeutsam, sich mit dem Internetgebrauch von Kindern und Jugendlichen eingehend zu beschäftigen, die Risiken zu studieren, aber auch die Potenziale auszuloten und stärker zu nutzen. So stellt beispielsweise eine 2008 in Amerika durchgeführte ethnografische Studie zu Peer-basierten Lerngewohnheiten unter Jugendlichen fest, dass elektronische Medien neue Möglichkeiten für intensives, selbstgesteuertes, interessengeleitetes Lernen eröffnen.72 Diese in der Fachsprache als »Geeking out« bezeichnete Lernmethode – das Aneignen und spätere Teilen von Expertenwissen unter Peers – gleicht in vielen Bereichen nicht dem traditionellen, Schulzimmer-basierten Unterricht, unterstützt aber dennoch auf interessante Weise technische und soziale Kompetenzen wie Selbstvertrauen, Führungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit. Dabei profitieren Jugendliche vom Umgang im digitalen Umfeld namentlich dadurch, dass sie sich soziale Fähigkeiten aneignen, die es für ein kreatives und auf Zusammenarbeit basierendes Arbeitsumfeld braucht.73 Während oft der Ruf laut wird, dass Kinder und Jugendliche besser vor bestehenden und zukünftigen Risiken und Gefahren geschützt werden sollen, ist es wichtig, die Vorteile zu erkennen, die die neuen Digitaltechnologien mit sich bringen. Durch das Experimentieren mit neuen Technologien im Unterricht können selbstgesteuertes und ausserschulisches Lernen gefördert und neue Formen der sozialen Interaktion entwickelt werden.
Erst die Zukunft wird verlässlich zeigen, in welchem Ausmass digitale Medien wie Handy und Internet informations- und kommunikationsbasierte Vorgänge wie das Lernen nachhaltig verändern. Immerhin besteht aber bereits jetzt eine reichhaltige Forschung zu den Chancen und Risiken der digitalen Mediennutzung, aus der sich gerade auch im Blick auf Schulen erste und vorsichtige Handlungsempfehlungen ableiten lassen.
2. Erkenntnisleitende Fragestellungen
Dieses Buch bezweckt ein »Umfeldmonitoring« in Sachen Internetrisiken für Kinder und Jugendliche in der Schweiz. Dabei werden namentlich die folgenden Aspekte diskutiert und Fragen beantwortet:
1. Welchen Risiken und Gefahren sind Kinder und Jugendliche bei der Nutzung des Internets ausgesetzt? Dabei sind sowohl kurzfristige Risiken und Gefahren (z. B. Mobbing) als auch langfristige Folgen (z. B. Hinterlassen von untilgbaren Informationen im Internet) zu berücksichtigen.
2. Welche Möglichkeiten bestehen, um für Kinder und Jugendliche diese Risiken und Gefahren – präventiv – zu minimieren?
3. Sind in Zukunft im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets für Kinder und Jugendliche Risiken und Gefahren zu erwarten, die heute noch von untergeordneter Bedeutung sind? Wenn ja, welche?
3. Methodologie
Primäres Datenmaterial
Die vorliegende Studie basiert auf einschlägigen Forschungsarbeiten aus dem In- und Ausland, wobei sowohl quantiative wie auch qualitative Befunde Berücksichtigung finden. Für die nachfolgende Darstellung der Risiken und Gefahren, die sich für Kinder und Jugendliche im Zusammenhang mit der Internetnutzung ergeben, wurde hauptsächlich Datenmaterial aus folgenden grösseren Studien aus dem deutschsprachigen Raum verwendet (weitere wichtige Quellen finden sich im Literaturverzeichnis):
1. JAMESfocus 201174
Willemse, I., Waller, G., & Süss, D. (2011). JAMESfocus – Mediennutzungstypen bei Schweizer Jugendlichen – zwischen Risikoverhalten und positivem Umgang. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Zuletzt abgerufen am 3. Februar 2012 unter: http://www.psychologie.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/psychologie/ Downloads/Forschung/James/Willemse_Waller_Su%CC%88ss_-_JAMESfocus_Bericht_31.01.2012.pdf.
2. JAMES-Studie 201075
Willemse, I., Waller, G., & Süss, D. (2010). JAMES – Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz. Zuletzt abgerufen am 3. Februar 2012 unter: http://www.psychologie.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/psychologie/ Downloads/Forschung/James/Ergebnisbericht_JAMES_2010_de.pdf.
3. JIM-Studie 201176
Behrens, P., & Rathgeb, T. (2011). JIM-Studie 2011: Jugend, Information, (Multi-) Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. Zuletzt abgerufen am 3. Februar 2012 unter: http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf11/JIM2011.pdf.
4. JIM-Studie 201077
Kutteroff, A., & Behrens, P. (2010). JIM-Studie 2010: Jugend, Information, (Multi-) Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. Zuletzt abgerufen am 3. Februar 2012 unter: http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf10/JIM2010.pdf.
5. JIM-Studie 200978
Kutteroff, A., & Behrens, P. (2009). JIM-Studie 2009: Jugend, Information, (Multi-) Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. Zuletzt abgerufen am 3. Februar 2012 unter: http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf09/JIM-Studie2009.pdf.
6. KIM-Studie 201079
Behrens, P., & Rathgeb, T. (2011). KIM-Studie 2010: Kinder und Medien, Computer und Internet. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. Zuletzt abgerufen am 3. Februar 2012 unter: http://www.mpfs.de/fileadmin/KIM-pdf10/KIM2010.pdf.
7. KIM-Studie 200880
Kutteroff, A., & Behrens,