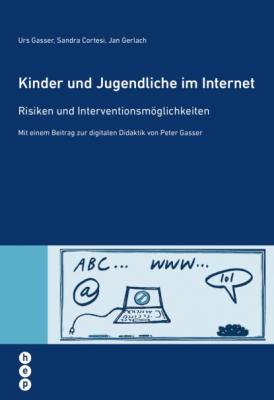ТОП просматриваемых книг сайта:
Kinder und Jugendliche im Internet. Jan Michael Gerlach
Читать онлайн.Название Kinder und Jugendliche im Internet
Год выпуска 0
isbn 9783039059072
Автор произведения Jan Michael Gerlach
Жанр Документальная литература
Издательство Bookwire
Zusammengefasst: Viele junge Menschen mit Internetzugang haben heute eine weitreichende und beeindruckende Medienkompetenz, die sie mit selbstorganisiertem, informellem Lernen erworben, ausgetauscht und im Sinne des Web 2.0 eingesetzt haben. Sie holen sich die gewünschten Informationen aus dem Netz, sie nutzen mit ihren Geräten Internet und soziale Netzwerke wie Facebook usw., tauschen Informationen aus, bauen eine digitale Identität auf, nutzen Open-Source-Lernplattformen, übermitteln und teilen Nachrichten, Texte und Bilder, nutzen Film-, Musik- und Spielangebote – oft auch ausserhalb des wünschenswerten Rahmens. Die Schule kann und muss diese Ressourcen nutzen und einbeziehen20 sowie zur Kenntnis nehmen, dass das mit mobilen Endgeräten nutzbare Internet- und Digitalangebot in lerntheoretischer Sicht der bislang exzellenteste und konsequenteste Beitrag zum individualisierenden formellen und informellen Lernen ist. Die Schule muss aber auch den entsprechenden Gefahren gegensteuern und mithin jene jungen Nutzerinnen und Nutzer fördern, deren Teilnahmechancen (im Rahmen des sich manchenorts eröffnenden sogenannten »participation gap«) geringer ausgefallen sind. Wenn die Chancen genutzt werden sollen, ist im geschilderten Sinne teilweise ein Paradigmenwechsel der Lehr- und Lern-Formen nötig. Zudem sind auf verschiedenen Ebenen entsprechende Informatikangebote – inklusiv angemessene Zeitgefässe für den Unterricht – zu machen, finanziell und personell differenziert zu unterstützen sowie die lehrspezifischen Medienkompetenzen der Lehrenden auf- und auszubauen. Die besondere informationelle Qualität der Beiträge von Lehrpersonen liegt meines Ermessens nicht nur im Beschaffen, Einrichten und Betreiben technologischer Geräte, in deren Handhabung und digitale Nutzung im Sinne von ICT, sondern in der weiterführenden und vertiefenden, hintergrundkundigen Aufklärung unter Einschluss nicht nur der jungen Menschen, sondern auch der Erziehungsverantwortlichen (inkl. Eltern), die sich gegen Internetmythen richtet und dem journalistischen und eindimensionalen Feldzug gegen Informatik und Internet entgegenstellt. Dies soll abschliessend an drei brisanten und aktuellen Themen erläutert werden.
(1) Führt das extensive Multitasking junger Menschen vermehrt zu Aufmerksamkeitsstörungen und Konzentrationsdefiziten?
In manchen Hörsälen referiert vorne eine Dozentin oder ein Dozent, die Studierenden sitzen hinter ihren Laptops, machen Notizen, rufen im Internet Schlüsselbegriffe ab, ordnen ihre E-Mails, senden oder empfangen hin und wieder auch Botschaften über iPhone – und fühlen sich nach eigenen Aussagen wohl und überhaupt nicht überfordert. »I multitask every single second I am online. At this very moment, I am watching TV, checking my email every two minutes, reading a newsgroup about who shot JFK, burning some music to a CD and writing this message«, berichtet ein Siebzehnjähriger.21 Dieses Verhalten nennen wir mediales »Multitasking«. Eine Studie aus dem Jahr 2003 belegt, dass »fast ein Drittel der untersuchten Jugendlichen beim Hausaufgabenmachen meistens telefoniert, chattet, fernsieht, Musik hört oder im Internet surft«.22
Multitasking beschäftigt in erster Linie das Arbeitsgedächtnis, mithin Areale des frontalen Cortex. Wenn wir mit Torkel Klingberg annehmen,23 dass Multitasking vom Belastungsgrad des Arbeitsgedächtnisses abhängt und dass gewisse »Exekutivfunktionen« desselben trainierbar sind, lässt sich die Vermutung anstellen, dass Digital Natives, die sich täglich stundenlang mit mehreren digitalen Endgeräten gleichzeitig beschäftigen, sich auch eine entsprechende Parallelverarbeitung aneignen. Und genau dies scheint der kritische Punkt zu sein: Wenn die zu bewältigenden Aufgaben hoch habitualisiert und automatisiert sind, reicht die neuronale Stirnhirn- und Aufmerksamkeitskapazität aus: Wir können durchaus ein Auto lenken und dazu ein Gespräch führen oder Musik hören. Die Kombination von Autofahren und mit dem Handy jemanden anrufen übersteigt diese Kapazitätsgrenze und führt unweigerlich zu hohem Aufmerksamkeitsverlust und zu Fehlreaktionen. Dies hat zum Verbot des Handygebrauchs während des Autofahrens geführt.
Mittlerweile gibt es eine wahre Flut von Multitasking-kritischen Artikeln und Büchern. Der amerikanische Wissenschaftsjournalist Nicolas Carr warnte (2008) nicht nur mit einem wegweisenden Artikel »Is Google making us stupid?« vor den Untiefen des Internets, er befürchtet auch, dass das Multitasking Konzentrationsfähigkeit, Nachdenklichkeit und Reflexionstiefe zerstört. Im deutschen Sprachraum warnt der Journalist Frank Schirrmacher mit deftigen Titeln wie »Multitasking ist Körperverletzung«.24 Die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel verweist darauf, dass die konstante Überforderung des Multitaskings zu einer markanten Aufmerksamkeitsstörung führen kann – und sie bezeichnet darüber hinaus Multitasking als Mythos, denn das Gehirn könne niemals gleichzeitig zwei anspruchsvolle Aufgaben parallel bearbeiten. Wir müssten vielmehr eines nach dem andern tun, das heisst ein »serielles Multitasking«25 pflegen – oder zwischendurch »einfach abschalten«.26 Zwar räumt der amerikanische Neurowissenschaftler Gary Small ein, Multitasking bzw. das Hin- und Herspringen zwischen zwei Aufgaben sei offenkundig zu einer notwendigen Fähigkeit geworden, aber mit psychischen Unkosten verbunden, zum Beispiel mit Zeitverlust beim Aufmerksamkeitswechsel und darüber hinaus mit der Gefahr des Erwachsenen-ADHS.27 Small kommt zum Schluss: »Wenn wir das Multitasking minimieren, verbessern wir damit im Allgemeinen unsere Konzentrationsfähigkeit.«28 Prägnant ablehnend äussert sich auch Manfred Spitzer: »Multitasking – Nein danke!«.29 Er belegt seine ablehnende Haltung gegenüber Multitasking (wie übrigens auch Gary Small, Lutz Jäncke und andere) mit dem Hinweis auf eine amerikanische Untersuchung von Clifford Nass et al.,30 in welcher Extremgruppenvergleiche zwischen intensiven und leichten Multitaskern und Multitaskerinnen gemacht wurden. Die Ergebnisse waren eindeutig:
Je mehr Distraktoren (ablenkende Reize) im Spiel sind, desto schlechter sind die Heavy-Multimedia-Users.
Je schwerer die Arbeitsgedächtnis-Aufgabe ist, desto schlechter sind die Heavy-Multimedia-Users.
Je schwerer die Multitasking-Aufgabe, desto langsamer arbeiten die Heavy-Multimedia-Users.
Gesamthaft kann man sagen: Intensives und anhaltendes Multitasken reduziert die Fähigkeit, irrelevante Inhalte auszublenden, verlangsamt den Aufgabenwechsel – und führt schliesslich zu einem oberflächlicheren und weniger effektiven kognitiven Stil.
Einen erhellenden Beitrag zum Problem Multitasking hat jüngst Etienne Koechlin vom Laboratoire de Neurosciences Cognitives in Paris publiziert.31 Er konnte nachweisen, dass zwei konkurrierende Aufgaben auf die Frontalaktivität der beiden Hemisphären aufgeteilt werden – und damit auf eine wohl strukturelle neuronale Kapazitätsgrenze stösst: Die Studie belegt, dass das Gehirn maximal zwei Aufgaben gleichzeitig bewältigen kann.
Damit ist ein handlungsrelevantes Fazit zu ziehen: Multitasking ist im Normalfall wahrscheinlich gehirnstrukturell und durch die Aufgabenschwierigkeit limitiert. Hoch automatisierte Handlungen erlauben es allenfalls, zwei Aufgaben parallel zu bearbeiten – allerdings mit dem erhöhten Risiko, mehr Fehler zu machen, die Konzentration und Aufmerksamkeit zu überfordern und letztlich mehr Zeit zu benötigen. Bei anforderungsreichen Aufgaben ist das Nacheinander konzentrierter Zuwendung lernpraktisch optimaler – und sogar für den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben günstiger.
(2) Machen Computerspiele Jugendliche gewalttätig oder klug?
Das vom Psychiater und Neurowissenschaftler Manfred Spitzer 2005 publizierte Buch »Vorsicht Bildschirm« wirkte wie ein Fanal im Feldzug gegen Computer- und Internetspiele – und darüber hinaus gegen deren Einsatz in der Schule. Spitzer erwähnt mehrere Schulamokläufe (Littleton, Erfurt usw.), deren Täterinnen und Täter »sehr viel Zeit mit dem Spielen von Gewaltvideospielen« verbracht, somit Gewalt aktiv und selbstbelohnt