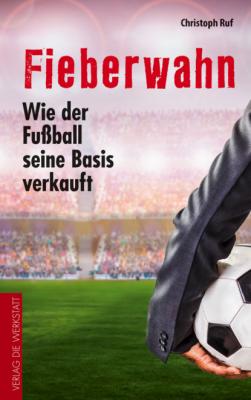ТОП просматриваемых книг сайта:
Fieberwahn. Christoph Ruf
Читать онлайн.Название Fieberwahn
Год выпуска 0
isbn 9783730703601
Автор произведения Christoph Ruf
Жанр Сделай Сам
Издательство Bookwire
Doch es gäbe noch eine viel bessere Lösung, eine, die auf Applaus in der 3. und 4. Liga stoßen und von den Fans bejubelt werden würde. Und das wäre eine Regionalliga ohne die U-Mannschaften der Profivereine. Für die könnte man eine Nachwuchsliga einrichten und hätte mit einem Mal 21 Regionalligisten weniger – also in etwa eine ganze Spielklasse eingespart. Vier Aufsteiger, vier Absteiger und überall glückliche Menschen. Nur nicht bei den DFL-Vereinen. Doch die müssten sich dann die Frage gefallen lassen, warum sie die Regeln in einer Liga bestimmen wollen, die sie ansonsten behandeln wie einen aussätzigen Verwandten, mit dem man partout nichts zu tun haben möchte.
Geheimes Zusatzabkommen
Die Probleme des DFB, sie fangen definitiv auf der Ebene der Landesverbände an. Und sie hören oben noch lange nicht auf, denn seit der Affäre um das »Sommermärchen«, in deren Folge Präsident Wolfgang Niersbach und sein Generalsekretär Helmut Sandrock hatten zurücktreten müssen, ist der DFB angeschossen: in der öffentlichen Wahrnehmung, in der ausweislich mehrerer Umfragen das Image des Verbands stark gelitten hat, und natürlich infolgedessen auch gegenüber der DFL, die im deutschen Fußball schon lange den Ton angibt und seit dem Herbst 2015 erst recht Oberwasser hat. »Damals war der DFB am Implodieren und Explodieren zugleich«, sagt ein Vertreter eines westdeutschen Landesverbandes des DFB. Vor diesem Hintergrund war es wohl schon ein Erfolg, Reinhard Grindel gegen den erklärten Willen zahlreicher Granden aus den Profiklubs als neuen DFB-Präsidenten durchzubringen – auch wenn sich seither mancher fragt, woher eigentlich das Gerücht stammt, dass Grindel ein »Mann der Amateure« sei. Sieht man einmal davon ab, dass sein Desinteresse an den unteren Ligen nicht ganz so offensichtlich ist wie bei seinem Vorgänger Niersbach, hat sich seit dem Stabwechsel offenbar nicht viel geändert.
Koch, der sich im Vorfeld sehr für Grindel eingesetzt hatte, sieht das anders. Er lässt aber durchblicken, dass weder er selbst noch Grindel bei den Verhandlungen um die Verlängerung des Grundlagenvertrags unter diesen Vorzeichen mehr hätten aushandeln können als eine Lösung, die zum ersten Mal in den vergangenen Jahren so richtig ins öffentliche Bewusstsein rückt, wie enorm die Kluft zwischen dem Profifußball und seiner Basis geworden ist. Mit dem Grundlagenvertrag wurde der DFL vor 16 Jahren das Recht übertragen, die Vermarktungsrechte der Profiklubs eigenverantwortlich zu verwerten. Vereinbart wurde eine Art Pacht in Höhe von drei Prozent der Medien- und Ticketeinnahmen. Schon das war nicht viel, doch proportional müssen die Profis – wie kurz darauf enthüllt werden wird – jetzt noch weniger abgegeben, was man durchaus als getreues Abbild der Machtverhältnisse im deutschen Fußball deuten kann. Während auf die 36 Profiklubs jährlich 1,16 Mrd. Euro entfallen, hätten dem gesamten Amateurfußball gerade mal 35 Mio. Euro zugestanden, abzüglich der 20 Mio. Euro aus den Erlösen mit dem DFB-Team, die in umgekehrte Richtung fließen, wohlgemerkt. Doch selbst diese 15 Mio. Euro flossen letztlich nicht, denn es gab ein geheimes Zusatzabkommen zum Grundlagenvertrag.
Und wie vieles, das geheim gehalten wird, geschah dies deshalb, weil jemand, in diesem Fall der DFB, zu Recht einen Sturm der Entrüstung befürchtete. Demnach werden seit 2013 Zahlungsflüsse in beide Richtungen gedeckelt. So muss die DFL dem DFB pro Jahr nur 26 Mio. Euro zahlen und bekommt 20 Mio. Euro aus der dem DFB obliegenden Nationalmannschaftsvermarktung zurück. Per Saldo erhält der DFB also lächerliche 6 Mio. Euro aus einem TV-Vertrag, der für die Saison 2017/18 wieder einen Rekordwert ausweist, doch der Amateurfußball partizipiert an den Zuwächsen nicht mehr proportional. Auch hier geht die Schere also weiter auseinander. Die 36 deutschen Profiklubs erhalten pro Jahr rund 1,16 Mrd. Euro statt bislang 680 Mio. Euro an Medienerlösen. Doch dafür gibt der DFB noch einmal zusätzliche 5 Mio. Euro jährlich an die Landesverbände, on top kommen weitere 3 Mio. Euro aus eigenen Mitteln. Die DFL stellt noch einmal 2,5 Mio. Euro jährlich für konkrete Projekte im Rahmen des »Masterplans Amateurfußball« bereit. Zum Vergleich: Das entspricht dem Jahressalär eines leicht überdurchschnittlichen Bundesligaspielers.
Dass das alles aus Sicht des DFB, vor allem aber aus Sicht der 25.000 Fußballvereine, ein richtig schlechtes Ergebnis ist, weiß auch Rainer Koch. Er gab schon unmittelbar nach Veröffentlichung des Verhandlungsergebnisses ein Interview, in dem er betonte, dass das Amateur-lager enttäuscht sei, wobei auch er es damals nicht für nötig befand, die Öffentlichkeit über das Zusatzabkommen zu unterrichten. »Die 2,5 Mio. Euro lösen angesichts der 1,16 Mrd. Euro keine La Ola bei der Basis aus«, sagte Koch der Sport Bild: »Die Einheit des Fußballs zwischen Amateuren und Profis ist aber wichtiger als jeder Euro, und deshalb muss es darum gehen, die Liga zu überzeugen, dass sie von sich aus und freiwillig deutlich mehr Geld für die Talentförderung an der Fußball-Basis gibt.«
Kein Pirmasens-Trikot zu Weihnachten
Diesen Standpunkt vertritt er noch im April 2017: »Unser Weg ist es, die Einheit von DFB und DFL zu erhalten und dafür zu kämpfen, dass es finanzielle Verbesserungen für den Amateurfußball gibt.« Und an die Adresse von Amateurvertretern wie Engelbert Kupka und dessen Initiative »Rettet den Amateurfußball« gerichtet, ergänzt er: »Die sture Konfrontation mit der DFL bringt uns kein bisschen weiter.«
Dass der Kicker jüngst eine überaus erfolgreiche Serie mit dem Titel »Der Riss« gestartet hat, in der er über die Nöte und den Ärger an der Basis berichtet, sorgt bei Koch ebenfalls nicht für eine La Ola: »Objektiv gibt es diesen ›Riss‹ nicht«, sagt er, der sich gleichwohl in den letzten Jahren sehr viele Gedanken gemacht hat. Denn dass die Stimmung an der Basis oft miserabel ist, das stellt er ja gar nicht in Abrede: »Was stimmt, ist, dass an der Basis zum Teil das Gefühl herrscht, verlassen zu sein. Doch dieses Grundgefühl hat weniger mit den Verbänden als mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun. Der Staat zieht sich immer weiter zurück aus der Unterstützung von gesellschaftlichem Engagement – er pflegt z. B. die Sportanlagen weit weniger als früher – und findet keine Antwort auf den demografischen Wandel.« Dessen Folgen spüre der Fußball aber massiv: »In der Stadt, wo es viele junge Menschen gibt, fehlen die Sportanlagen, auf dem Land gibt es die, aber es fehlen die Sportler. In der Summe führt das dazu, dass Sportvereine sterben. Mit einer sinkenden Attraktivität von Fußball hat das nichts zu tun.«
Diese Analyse würde wohl vom Präsidenten eines fränkischen C-Klasse-Vereins bis zum Manager von Rot-Weiss Essen so gut wie jeder unterschreiben, doch während viele von denen die fehlende Wertschätzung der Verbände, vor allem aber die unfaire Verteilung der im Fußball erwirtschafteten Gelder anmahnen, ist Koch schon einen Schritt weiter. Weder glaubt er, dass sich die Kommerzialisierung zurückdrehen lässt, noch, dass der Trend dahin gehen wird, dass zehntausende Menschen sonntags wieder den Kick in ihrem Ort einer Übertragung auf Sky vorziehen werden.
Eine Rückkehr in die Vergangenheit, davon ist Koch überzeugt, die wird es deshalb nie mehr geben. Weder werden die Zuschauerzahlen bei den Amateuren plötzlich wieder anschwellen, noch werden die 2014 Geborenen es anders machen als der Jahrgang 2008 und sich massenhaft Shirts des FK Pirmasens oder des KFC Uerdingen statt von Bayern oder Barça zu Weihnachten wünschen. Deshalb hält Koch auch letztlich die gesamte Diskussion für rückwärtsgewandt. Nicht nur, weil jede grundsätzliche Veränderung an den realen Machtverhältnissen im Fußball scheitern würde, sondern weil der Fußball ein System ist, das in Wechselwirkung zum Rest der Gesellschaft steht. Er ist deswegen so kommerziell, weil die Gesellschaft so kommerziell ist.
Die Tim-Wiesierung des Amateurfußballs
Und weil man das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen kann und die Gesellschaft nun mal so eventfixiert ist, glaubt Koch, dass die unteren Ligen sich umstellen müssen. Mehr Thrill in der Endphase einer Saison, zusätzlich geschaffene Events, die die Kameras anlocken. Wer rückwärtsgewandte Lösungen propagiere, habe die Mehrheit der Menschen gegen sich. »Man wird an dieser Stelle auf Dauer nicht ansatzweise von der Bevölkerung unterstützt werden, weil