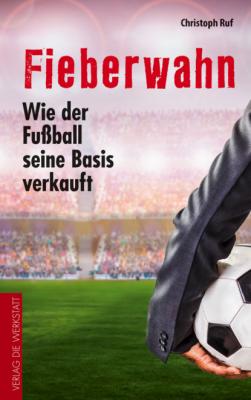ТОП просматриваемых книг сайта:
Fieberwahn. Christoph Ruf
Читать онлайн.Название Fieberwahn
Год выпуска 0
isbn 9783730703601
Автор произведения Christoph Ruf
Жанр Сделай Сам
Издательство Bookwire
Ähnlich wirtschaftet man beim FC Nöttingen, einem mittelständisch strukturierten Verein aus Baden, der auf Amateure setzt und seit Jahren zwischen Oberliga und Regionalliga pendelt. »Profitum in der Regionalliga geht eigentlich nicht«, sagte dessen Vorsitzender Dirk Steidl der Pforzheimer Zeitung. Viele Klubs zahlten schlicht deutlich höhere Gehälter, als sie sich leisten könnten, glaubt Steidl, der für seinen Verein in der Regionalliga mit 350.000 Euro kalkuliert. Mehr als in Bonn oder Nöttingen sollte wohl generell in der Regionalliga nicht bezahlt werden – sonst droht der finanzielle Kollaps.
Es sei denn, man verfügt über einen klassischen Mäzen wie Franz-Josef Wernze bei Viktoria Köln oder man ist ein Provinzklub, der das Glück hat, von einem reichen Geschäftsmann zum Betätigungsfeld erkoren worden zu sein. Davon gibt es einige in den fünf Regionalligen. Auch der Meister der Regionalliga Südwest, der SV Elversberg, wäre ohne seinen Gönner und Präsidenten Dominik Holzer, den Chef eines Pharmakonzerns, ein ganz normaler Dorfverein. So wäre beinahe eine Mannschaft in die 3. Liga aufgestiegen, die bei Heimspielen kaum einmal mehr als 1.000 Zuschauer hat.
Aufstieg? Lieber nicht
2010 wurden die Abschaffung der dreigleisigen Regionalliga und die Einführung der fünfgliedrigen zur Saison 2012/13 beschlossen. In jener Saison wechselte auch die Hauptverantwortlichkeit für die Regionalliga vom DFB auf die Landesverbände. Vor der Ligareform 2012 hatte der Deutsche Fußball-Bund immerhin noch mehr als 5 Mio. Euro an die Vereine der drei Staffeln ausgeschüttet, nun fließt gar nichts mehr, doch die Kosten sind gestiegen. Kein Wunder also, dass mehr als ein Dutzend Klubs seitdem auf den Aufstieg verzichtet hat. Hunderte Oberligisten meldeten aus finanziellen Gründen erst gar nicht für die nächsthöhere Spielklasse, um im Fall der Fälle nicht tatsächlich hochzumüssen. So kommt es immer wieder zu Konstellationen, die mit einem regulären und fairen sportlichen Wettbewerb nichts mehr zu tun haben. In der Saison 2015/16 etwa nahm Altona 93 an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga teil – und das als Tabellensechster! Die ersten fünf der Oberliga Hamburg hatten dankend abgewunken. 2014 wollte sogar kein einziger Verein aus Hamburg, Mittelrhein und Hessen aufsteigen.
Noch ein paar Jahre zuvor, als die Regionalliga in ihrer jetzigen Struktur aus der Taufe gehoben wurde, hatte man sich das ganz anders vorgestellt. Die Regionalliga sollte ein Erfolgsmodell werden, ein Fest für jene Fußballfreunde, die alle paar Wochenenden Lokalderbys sehen wollen, vor gut gefüllten Rängen und auf einem sehr ordentlichen sportlichen Niveau. Das ist tatsächlich eingetreten, ansonsten blieben die meisten Versprechen unerfüllt – zumindest für die Vereine. Die Reform stärkte allerdings die Landesverbände des DFB. So wurden die Vermarktungsrechte an die Verbände abgetreten, die nun auch Gebühren für Ton- und Bildaufnahmen kassieren können. Schon daran entzündete sich Kritik. Dabei ist weitgehend unstrittig, dass Vereine wie der VfR Garching oder die TSG Sprockhövel unterm Strich gut mit der zentralen Vermarktung fahren. Doch viele Vereinsvertreter halten dem DFB und seinen 21 Untergliederungen vor, einen überdimensionierten Apparat zu alimentieren. Es spricht einiges dafür, dass dem deutschen Fußball wie auch der deutschen Politik schon bald eine Föderalismusdebatte droht. So richtig einsichtig ist es ja auch nicht, dass es einen Südbadischen und einen Badischen Fußballverband geben muss. Eines ist jedenfalls klar: Eine Liga, in die viele gar nicht hineinwollen und aus der zwei von fünf Meistern nicht hinausdürfen, hat ein ziemlich großes Problem.
»Regionalliga muss Regionen abbilden«
DFB-Vizepräsident Rainer Koch will das gar nicht in Abrede stellen, aber beim intensiven Gespräch im April 2017 in den Räumen des Bayerischen Fußball-Verbands die Gelegenheit nutzen, um einmal mit ein paar Vorurteilen über sich, den BFV und die Regionalligen aufzuräumen. Koch weiß ja, dass von Nord bis Südwest gerne kolportiert wird, die derzeitige Ligeneinteilung mit Bayern als einer von fünf Spielklassen sei ein Zugeständnis an das mächtige Bundesland mit seinem mächtigen Fußballverband gewesen. Kompletter Unsinn, wie Koch versichert, sein BFV habe 2012 zwar auf die Eigenständigkeit gedrängt, sich aber generell für eine stärkere Regionalisierung eingesetzt. »Wir wollten damals acht Spielklassen, konnten uns damit aber nicht durchsetzen.« Mehr Lokalderbys, kürzere Reisen – Koch findet die Idee noch heute charmant. Die »Region« in »Regionalliga« will er durchaus wörtlich verstanden wissen.
Die Klagen der Großen – von Saarbrücken bis Essen und von Aachen bis Cottbus – findet er nicht nur in der Sache unbegründet. Man merkt ihm auch an, dass er im Zweifelsfall lieber die Interessen der kleineren Vereine vertritt, wenn die im Widerspruch zu denen derjenigen stehen, die schon mal in der 2. oder 1. Liga gespielt haben und lieber heute als morgen dorthin zurückwollen. Ohne Vereine beim Namen zu nennen, sagt er also: »Eine Vereinspolitik, die Insolvenz in Kauf nimmt im Falle eines Scheiterns, ist von vorneherein unseriös.« Wenn Vereine wie Lotte und Würzburg den Aufstieg schafften, müsste das für die großen Beschwerdeführer mit ihren vergleichsweise hohen Etats doch auch möglich sein. Und überhaupt: »Es kann doch nicht die Lösung sein, eine Ligareform zu konstruieren, die ausschließlich auf das Dutzend Vereine zugeschnitten ist, das unbedingt hochwill. Diese Klubs müssen aufhören, Lösungen vorzuschlagen, die nur ihnen nutzen. Das ist rücksichtslos gegenüber allen anderen, vor allem auch den fast 200 Oberligavereinen in Deutschland, für die die Regionalliga erreichbar bleiben muss.«
Man merkt, dass Koch, der fraglos – wie die meisten im bezahlten Fußball – ein guter Strippenzieher ist, jahrzehntelang auch auf dem Fußballplatz sozialisiert wurde. Denn er präsentiert ein Argument, das in der gegenwärtigen Debatte selbst von Traditionalisten nur selten zu hören ist: »Wenn Sie sich einmal die Landkarte des Fußballs anschauen und einen Strich von Nord nach Süd mittendurch ziehen, dann werden Sie feststellen, dass sie links vom Strich viele Menschen und wenige Schafe haben – und im Osten des Strichs ist es umgekehrt«, sagt Koch. Und während sein Gegenüber noch die Städte von links nach rechts und von rechts nach links gruppiert, fährt er fort: »Regionalliga muss Regionen abbilden, sonst macht man ganze Regionen platt.« Sprich: Neugersdorf, Meuselwitz und Hof haben genauso eine Existenzberechtigung in der 4. Liga wie Essen oder Mannheim. Koch bringt jetzt noch ein paar Vereine aus seinem Verband ins Spiel, Memmingen oder Buchbach, einen Marktflecken mit 3.000 Einwohnern, aber fast 900 Zuschauern im Schnitt. Der Subtext ist klar: Vereine, die solide wirtschaften, nicht mehr sein wollen, als sie sind, und Spaß daran haben, wenn einmal im Jahr neben Garching auch noch die Fanhorden des TSV 1860 München vorbeikommen, denen gehört seine Sympathie. Vor allem aber glaubt Dr. Rainer Koch, dass man so bescheiden wirtschaften muss wie Memmingen oder Buchbach, um in der Regionalliga bestehen zu können.
U23-Teams – eine Klasse für sich
Bliebe allerdings noch die Krux mit den Relegationsspielen, die das vermeintlich eherne Prinzip ersetzen, dass der jeweils Erste einer Spielklasse automatisch aufsteigt. Glücklich mit dieser Lösung ist niemand, schon gar nicht die Topteams. Doch es ist schwer, einen Konsens darüber zu erzielen, wie die Ligen zugeschnitten sein müssten, um die Aufstiegsregelung fairer zu gestalten. Würde man die Regionalliga wieder von fünf auf drei Staffeln reduzieren, hätte man wieder drei Aufsteiger – aber eben auch 40 Teams, die dann nur noch fünftklassig spielten. Das wäre jedenfalls ebenso wenig konsensfähig wie eine zweigleisige 3. Liga, in die man ebenfalls vier oder auch fünf Teams aufsteigen lassen könnte. Doch dafür sind weder die Dritt- noch die Viertligisten. Denn die wäre weder vermarktbar, noch wäre sie attraktiv für die Fans.
Zwei andere Lösungen wären allerdings fair und zumindest bei einer Abstimmung in den Regionalligen wahrscheinlich auch mehrheitsfähig. Eine Möglichkeit