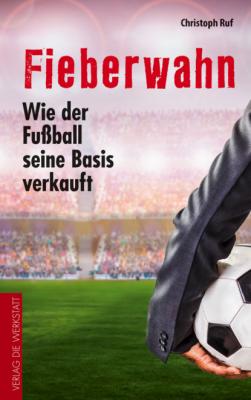ТОП просматриваемых книг сайта:
Fieberwahn. Christoph Ruf
Читать онлайн.Название Fieberwahn
Год выпуска 0
isbn 9783730703601
Автор произведения Christoph Ruf
Жанр Сделай Сам
Издательство Bookwire
Dass Irren menschlich ist, darf in dem Fall nicht als Relativierung herhalten, im Gegenteil. Denn gerade weil Menschen irren, ist es unverantwortlich, routinemäßig Alles-oder-nichts-Spiele anzusetzen, die dann durch die getrübte Sinneswahrnehmung eines einzigen Menschen entschieden werden können. Das ist schon bei einem Spiel am 13. Spieltag ärgerlich. Bei Partien, in denen es um die Zugehörigkeit zur Spielklasse und – bei der Relegation zwischen 1. und 2. Liga – um hohe zweistellige Millionenbeträge geht, ist es grob fahrlässig. Relegationsspiele haben viel mit Lotterie zu tun, viel mit Entertainment und wenig mit Sport.
Ein Spektakel moderner Gladiatoren
Genau aus diesem Grund ist die Relegation ligaübergreifend auch in den Fanszenen denkbar unbeliebt. Es ist kein Zufall, dass auch 2017 bei allen Relegationsspielen »Fußball-Mafia DFB« respektive »Scheiß DFB« gerufen wurde – zum Teil selbst von den Haupttribünen, die auch die zahlreichen Transparente gegen die vermeintlichen Endspiele beklatschten. Sicher wäre es zynisch, wenn man Fanausschreitungen wie beispielsweise in Braunschweig oder München ausschließlich der Relegation zuschriebe. Denn kein noch so kruder Spielmodus rechtfertigt Gewalt. Doch die Verbände sollten sich schon fragen, ob es nicht heuchlerisch ist, nach Ende der Saison noch einmal Spieler (und damit auch Fans) in zu Alles-oder-nichts-Partien hochgejazzten Duellen aufeinandertreffen zu lassen und sich dann zu wundern, wenn die Emotionen auf dem Platz und auf den Rängen über den Eichstrich der Zivilisation hinausschießen. So zumindest sieht es Daniel Schneider, der Vorsänger der Karlsruher »Phönix Sons«, der über die Relegationsspiele schon 2012 sagte, es sei »fast wie bei Gladiatoren: In der Arena kämpft man ums Überleben, und die feinen Herrschaften amüsieren sich darüber.«
Die von DFB und DFL nach US-Vorbild zur Saison 2008/09 wieder eingeführten Relegationsspiele zur Bundesliga sind dann auch wieder ein augenfälliger Beweis, dass die Verbände zunehmend ihren eigenen Sport und dessen Charme nicht ernstnehmen. Wenn man als souveräner Meister nicht aufsteigen darf, ist das sportwidrig, ebenso wie auch der Drittletzte der 1. Liga einfach keinen weiteren Fallschirm verdient hat – sondern nichts anderes als den Abstieg. Umso beachtlicher, dass mit Jens Todt der Manager des HSV, der sich in den letzten Jahren zweimal nur durch die Relegation in der 1. Liga halten konnte, deren Abschaffung verlangte. Er zeigte damit die gleiche Größe wie Frankfurts Trainer Niko Kovač, der nach den gewonnenen Relegationsspielen 2016 gegen Nürnberg ebenfalls deren Ende forderte.
Doch um solche Argumente geht es kaum mehr im deutschen Fußball. Es geht nicht um die Fanszenen, und auch Fairness spielt immer weniger eine Rolle. Was zählt, ist der Fernsehzuschauer, denn der sitzt vor dem Medium, das das Geld einbringt. Und natürlich schaut sich ein fußballinteressierter Mittfünfziger vor irgendeinem Fernsehapparat in irgendeiner Stadt auch nach der Saison gerne ein weiteres Fußballspiel an, wenn ihm vorher ein paar Tage lang erzählt wurde, wie »brisant« und »dramatisch« doch alles wieder sei. 90 weitere Minuten Entertainment fürs Fernsehpublikum – genau darum geht es.
Todesfalle Regionalliga
Zurück zur Regionalliga, also der Spielklasse, die wie keine andere vom Relegationsunsinn betroffen ist, für deren Vertreter das aber nur ein Faktor von vielen ist, der für tiefen Frust sorgt. Unzufriedenheit bis hin zu offener Wut herrscht nämlich nicht nur bei den Vereinen, die wie Cottbus, Mannheim, Viktoria Köln oder Elversberg kurz vor bzw. sogar in den Relegationsspielen gescheitert sind, sondern bei all den gut 15 Klubs, die sich in den fünf Staffeln zu Höherem berufen fühlen, zum Beispiel also Aachen, Essen, Oberhausen, Saarbrücken und Lok Leipzig. Seit 2011 bzw. 2013 sind Essen und Aachen viertklassig. Und dennoch hatten beide selbst in der sportlich völlig unbefriedigenden Spielzeit 2016/17 einen Zuschauerschnitt um 7.800 (Essen) bzw. 6.500 (Aachen) und standen damit besser da als Zweitligist SV Sandhausen.
Allerdings haben die erwähnten Vereine mit ihren vielen tausend Fans in aller Regel vor dem Absturz auch gravierende Fehler gemacht und unseriös gewirtschaftet. Doch zu Recht haben sie das Gefühl, dass sie seither – in der Regionalliga – noch so seriös arbeiten könnten und dennoch keine Chance mehr hätten, jemals wieder nach oben zu kommen. Eine Krux, die aus ihrer Sicht fast zwangsläufig dazu führt, alles auf eine Karte zu setzen, sich also derart zu verschulden, dass sie die aufgenommenen Kredite bei einem Aufstieg bedienen könnten, ansonsten aber finanziell vor die Wand fahren. »Wir haben hier in der Regionalliga immer wieder Vereine, die ihren Spielern um die 7.000 Euro an Grundgehalt zahlen, mit Lohnnebenkosten und Prämien sind sie dann schnell bei 12.000«, sagt ein Insider aus der Regionalliga Südwest.
Vor dem Dilemma, dass die Rahmenbedingungen ihrer Spielklasse fast schon dazu verleiten, unseriös zu wirtschaften, wenn man nicht die nächsten zehn Jahre auf Platz 13 verbringen will, stehen letztlich auch die Drittligisten. Denn wirklich etwas zu verdienen ist nur dort, wo die Gelder aus dem üppigen TV-Vertrag verteilt werden, den die DFL ausgehandelt hat: in der 2. und erst recht in der 1. Liga.
Kein Wunder also, dass in der Saison 2016/17 so viele Vereine Insolvenz anmelden mussten oder sogar komplett von der Landkarte verschwanden. Dass darunter große Traditionsvereine sind, ist erst recht kein Zufall. Nachdem 2016 Kickers Offenbach mal wieder am Ende war, stellten 2017 weitere Vereine einen Insolvenzantrag, die einst mindestens in der 2. Liga gespielt haben und allesamt ein deutlich überdurchschnittliches Zuschaueraufkommen nachweisen. Alemannia Aachen und Hessen Kassel haben es dabei so geschickt angestellt, dass sie 2017/18 mit Punktabzügen weitermachen dürfen – die Hessen mit einem Punktabzug von neun Zählern. Die Sportfreunde Siegen und der FC Schönberg aus Mecklenburg-Vorpommern wollen sich die Regionalliga hingegen nicht mehr leisten und ziehen sich in den Amateurfußball zurück. Damit komplettieren sie die illustre Liste all der Traditionsvereine, die in den vergangenen Jahren ebenfalls zum Insolvenzberater mussten: Rot-Weiss Essen, Wuppertaler SV, SSV Ulm, FC Homburg, Borussia Neunkirchen, VfB Lübeck, SSV Reutlingen, FC Gütersloh, Rot Weiss Ahlen, Bonner SC, FSV Zwickau, 1. FC Lok Leipzig oder zuletzt der VfR Aalen und FSV Frankfurt. Oft fehlten nur fünfstellige Euro-Beträge. Das ist in der 1. Liga das Salär eines Durchschnittskickers bei einem Durchschnittsverein. Wohlgemerkt, das Monatssalär.
Sponsoren: schwierig
Nachdenklich stimmen sollte dann auch die Erklärung des Siegener Vorstands Gerhard Bettermann: »Die 3. Liga besitzt Argumente. Aber gegenüber der Regionalliga sind potenzielle Sponsoren skeptisch«, sagte er dem Bonner General-Anzeiger. »Viele sagen dann: Wenn ihr in der 3. Liga seid, können wir noch mal reden.« Doch in die 3. Liga kommt man eben nur mit einem ungesund hohen Etat – ein Teufelskreis, mit dem ein Verein wie Siegen allerdings insofern nichts zu tun hat, als er schon den Normalbetrieb in der 4. Liga nicht stemmen kann. »Seit drei Spielzeiten gibt es eine Unterdeckung des Etats, die immer wieder nur durch privates Engagement von Gönnern geschlossen werden konnte. Die Leute können und wollen wir nicht immer wieder beknien.« Seine Schlussfolgerung: »Man muss ehrlich sein und den Tatsachen ins Auge sehen – Siegen kann sich die Regionalliga nicht leisten.« Doch das gilt nicht nur für Siegen, das – wie im Nordosten Schönberg – nicht auf Profitum setzte, keine überhöhten Gehälter zahlte und sich auch sonst keinesfalls dem Größenwahn hingab.
Und genau das ist das Problem, denn ohne entsprechend kostspielige Strukturen und Spieler ist es fast unmöglich aufzusteigen. Das Vabanquespiel ist systemimmanent. Die Vereine stehen vor der Alternative, ein bisschen in der 4. Liga vor sich hin zu kicken und langsam, aber sicher der Vergessenheit anheimzufallen – oder ins Risiko zu gehen. Das führt dazu, dass selbst die Vereine, die den verständlichen Ehrgeiz ihrer vielen Fans bändigen, indem sie auf die wirtschaftliche Vernunft