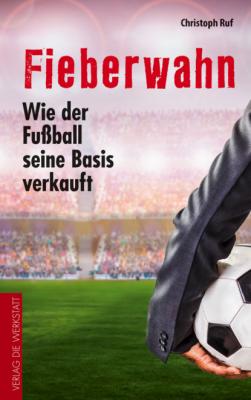ТОП просматриваемых книг сайта:
Fieberwahn. Christoph Ruf
Читать онлайн.Название Fieberwahn
Год выпуска 0
isbn 9783730703601
Автор произведения Christoph Ruf
Жанр Сделай Сам
Издательство Bookwire
Eine Antwort sind für Koch deshalb auch solche Events, wie sie im April 2017 der Kreisligist SSV Dillingen veranstaltete, als er für eine Partie den mit dem Präsidenten befreundeten Tim Wiese anheuerte. 1.000 Zuschauer kamen ins Stadion, über 700.000 Videoaufrufe verzeichnete alleine die Seite des Bayerischen Fußball-Verbandes, die das Spiel samt Drumherum übertrug. Und endlich hatte auch die Generation Facebook mal etwas zu besprechen, das nicht mit Ronaldo, Messi, Reus oder Neuer zu tun hatte. Genau wie es Koch vorschwebt: »Die Frage muss lauten: Was muss passieren, damit die heute Geborenen zu mir kommen, wenn sie im Alter von F-Jugendlichen sind? Das geht doch nur, indem ich ein Image schaffe, in dem transportiert wird, dass nicht nur Real, Bayern oder der BVB toll sind.«
Deswegen, so Koch, könne er auch die Klagen über die Liveübertragungen nicht nachvollziehen, die künftig bundesweit verstärkt im Internet gezeigt werden sollen. Es könne schon sein, dass der eine oder andere Zuschauer wegbleibe, weil er dann das Auswärtsspiel eben auf der Couch verfolge. Das müsse man allerdings mit dem Imagegewinn verrechnen. Das Beispiel Tim Wiese zeige doch, dass es einfacher sei, »zweimal im Jahr 600 statt 200 Zuschauer zu haben als 17-mal 30 mehr«. Kurzum: »Du wirst die Uhr nicht zurückdrehen und auch nicht die eventisierte Gesellschaft abschaffen können. Also musst du schauen, dass du selbst hin und wieder Events schaffst.«
Wäre es unfair, diesen Gedanken mit dem DFB-Pokalfinale 2017 zu verquicken? Vielleicht, schließlich war es nicht Rainer Koch, der auf die Idee kam, in der Halbzeitpause des Spiels zwischen Dortmund und Frankfurt Helene Fischer auftreten zu lassen. Doch seit dem 27. Mai 2017 dürfte es viele Millionen Menschen geben, für die ein für alle Mal bewiesen ist, dass beim DFB einige Leute arbeiten, die nicht so ganz instinktsicher sind, wenn es darum geht zu beurteilen, welche »Events« man Fußballfans schmackhaft machen kann und welche nicht.
Play-off-Spiele für alle
Doch Helene Fischer hin und chinesische U20-Mannschaften her: Koch hätte in seinem Beritt, dem Amateurfußball, ja schon ein paar Ideen, wie der Fußball in den unteren Spielklassen weiter vorankommen könnte. Play-off-Spiele für den Aufstieg und den Abstieg schweben ihm vor, wohlwissend, dass bei aller Kritik an den Relegationsspielen eben auch in den unteren Ligen die Zuschauerzahlen deutlich höher sind, wenn es am Ende der Saison noch mal um alles geht. Manche Kreisliga-Relegation findet da vor 800 Zuschauern statt, bei Aufstiegsspielen zur Oberliga kommen – wie beim Spiel des Freiburger FC gegen Backnang – schnell mal über 2.000 Zuschauer. Warum also sollte man nicht flächendeckend für ein paar Zuschauermagneten mehr sorgen? »Fußball ist die einzige Sportart, die noch auf Play-offs verzichtet; ich glaube, im Amateurfußball sind sie unausweichlich.«
Koch atmet tief durch, er ahnt, dass seine Pläne auf Widerstand stoßen werden, er glaubt aber, dass weite Teile der Basis ihn dabei unterstützen. Allemal zukunftsträchtiger jedenfalls seien Gedanken über die Zukunft als das, was er seit einigen Wochen immer wieder in der Zeitung und im Netz lese. Das Medienecho auf die Kampagne des langjährigen Hachinger Präsidenten Engelbert Kupka erscheint Koch vollkommen überdimensioniert. »Eine Initiative, die nach Monaten 1.400 Facebook-Likes hat und nicht einmal 100 von 25.000 Vereinen vertritt …«, schüttelt Koch den Kopf. »Die Initiative von Herrn Kupka bringt die Leute gegeneinander auf, anstatt die Stärken des Amateurfußballs zu entwickeln. Das und die Bereitschaft, mit einer Stimme zu sprechen, sind aber die einzige Chance, um den Amateurbereich wirklich nach vorne zu bringen.«
Solche Vorschläge, die für viele Fußballfans wie die Agenda des Grauens klingen, kommen von einem Mann, dem man zugutehalten muss, dass er weiter denkt als viele seiner Kollegen in den Landesverbänden. Wer sich in der Regionalliga Bayern oder den beiden Bayernligen umhört, erfährt, dass Koch im regen Kontakt mit den Vereinen steht, oft ist er am Wochenende auch auf der Tribüne. Das unterscheidet den BFV-Präsidenten, der privat möglicherweise gar nicht so viel Spaß an der Eventkultur hat, von vielen seiner 20 Kollegen, die lieber beim örtlichen Bundesligisten zuschauen oder dafür sorgen, dass sie in die Länderspieldelegationen für die Nationalmannschaft kommen. Über die wiederum kann sich ein anderer Mann stundenlang echauffieren, denn sie sind für ihn die Hauptschuldigen daran, dass der Amateurfußball von seinen eigenen Repräsentanten »verraten und verkauft« wird. Der Mann, der so prägnant formuliert, ist: Engelbert Kupka.
»Die Duma ist lebhafter als der DFB-Bundestag«
Von der Brienner Straße 50 in München, Sitz des BFV, zur Witneystraße 1 in Unterhaching sind es gerade einmal 25 Autominuten in südlicher Richtung. Kupka hat zum Interview in seine Anwaltskanzlei am Hachinger Stadtrand gebeten: schwere Holzmöbel, ein paar gerahmte Diplome, ein riesiger Aktenberg, rechtwinklig zur Schreibtischkante. Und ein bald 80-Jähriger, dem man das Alter weit weniger anmerkt als den Gemütszustand: Wenn Engelbert Kupka über Fußball redet, spricht ein wütender Mann. Am DFB-Bundestag in Erfurt, der den unvorteilhaften Grundlagenvertrag im Oktober 2016 erwartungsgemäß abgesegnet hat, lässt Kupka kein gutes Haar. »Die Delegierten wussten ja gar nicht, worum es geht«, meint er. »Das Beste, was den Chefs beim DFB passieren kann, ist doch ein nicht informierter Delegierter. Der nickt dann alles ab, was von oben kommt. Die 21 Landesfürsten sind da sowieso längst auf Kurs, die haben sie aus Frankfurt vorher ja auch schön eingenordet.«
Der typische DFB-Basisvertreter, so Kupka, höre dann auf, die Interessen der Basis zu vertreten, wenn daraus Diskussionen und Konflikte entstünden. »Die empfinden das als Ehre, da inmitten all der Großen rumzusitzen, und freuen sich, wenn Rummenigge ihnen die Hand gibt und ein gutes Essen serviert wird.« Für die Debattenkultur beim DFB hat Kupka ein strenges Urteil parat: »In der Duma in Moskau ging es lebhafter zu als heute im DFB-Bundestag.« Die Amateure aber hätten keine Stimme: »Der DFB verfährt da nach dem Motto ›divide et impera‹ und verweist auf die Landesverbände.« Doch von denen sei keine Gegenwehr gegen die DFB-Politik zu erwarten.
Dass eine solche Basis kein ernstzunehmendes Gegenüber für die DFL darstelle, dürfe keinen wundern, so Kupka. Doch so richtig sauer ist er nicht auf die braven Delegierten, sondern auf die Verbandsspitze und die Landesfürsten. Denn die hätten sich auf einen unappetitlichen Deal zu Lasten der Amateure eingelassen. Als Gegenleistung dafür, dass die DFL zähneknirschend einen DFB-Präsidenten Grindel akzeptierte, habe man den Grundlagenvertrag ebenso zähneknirschend abgenickt. »Koch hat hinter den Kulissen versucht, mehr zu erreichen, wurde aber von der DFL-Spitze um Rauball und Peter Peters abgekocht.« Das dürfte im Übrigen so stimmen und die Frage aufwerfen, wie der DFB je mit einer Stimme sprechen will, wenn er sich in den Landesverbänden einige Funktionäre leistet, die, was strategisches Denken angeht, ihren DFL-und (zumindest einigen) Vereinskollegen grandios unterlegen sind. Und die das nicht einmal zu stören scheint, weil sie Fans ihrer selbst und all der meist recht banalen Geschichten sind, die ja angeblich nur der Fußball schreibt.
Kupka betont häufig, dass es seiner Initiative nicht allein um mehr Geld gehe. Vielmehr sei der Amateurfußball zum Bittsteller verkommen, dessen Anliegen kein Gehör fände. Was umso schlimmer sei, als er für das Versagen der nationalen und internationalen Verbandsspitzen in Sippenhaft genommen werde. Angesichts der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in den höchsten Etagen von FIFA, DFB, UEFA und IOC leide das Image des gesamten Fußballs. »Da sagen die Sponsoren: Ihr habt doch genug Geld, verteilt es richtig.«
Was Kupka vorschwebt, ist ein anderer Verteilungsschlüssel, nach dem das Geld 40:60 an DFB und Vereine aufgeteilt wird. Damit könnten Baumaßnahmen von Fußballplätzen ebenso gefördert werden wie Qualifizierungsmaßnahmen für ehrenamtliche Funktionäre. Die Krux daran: Auch DFB-Funktionäre wie Koch hätten