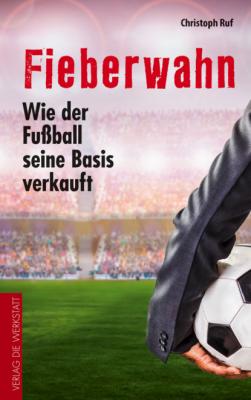ТОП просматриваемых книг сайта:
Fieberwahn. Christoph Ruf
Читать онлайн.Название Fieberwahn
Год выпуска 0
isbn 9783730703601
Автор произведения Christoph Ruf
Жанр Сделай Сам
Издательство Bookwire
Einen ganzen Tag verbringe man in der Woche zuweilen alleine damit, solche Formalia zu erledigen, dazu noch Turniere im Sommer und Winter zu organisieren, Spielverlegungen auf die Beine zu stellen oder zu prüfen, ob jedes Ergebnis jeder einzelnen Mannschaft von den Trainern auch fein säuberlich in die Online-Portale eingepflegt worden ist. Denn – wir ahnen es bereits – auch wer das unterlässt, wird zur Kasse gebeten. Und das ist letztlich der Grund, warum Beune und seine Kollegen die ganze Sache mit dem Strafenkatalog dann doch eher negativ sehen. »Zum einen hat das Ausmaße angenommen, dass die ganzen formalen Anforderungen längst den Spaß am Fußball minimieren«, sagt Beune. »Und zum anderen liegt halt der Verdacht auf der Hand, dass es den Verbänden nicht nur ums Disziplinieren der Vereine geht.« Sondern schlicht und einfach darum, ihren Etat zu finanzieren. »Wie gesagt: Ich verstehe den Sinn von Trainingsfreigaben. Aber wenn man mindestens 100 Euro bezahlen muss, wenn man einmal eine vergisst, dann liegt doch der Verdacht nah, dass da jemand eine lukrative Einnahmequelle aufgetan hat.«
Es ist schon komisch: Während im Kleinen eine Regelungswut herrscht, die noch für jedes Kreisliga-C-Spiel einen Ordner vorsieht, wird die Regelung, die den deutschen Fußball starkgemacht hat, von interessierter Seite attackiert. Die 50+1-Regel, die bis dato dafür sorgt, dass es im deutschen Fußball auch noch um Fußball geht, gerät zunehmend unter Beschuss.
Visier nach oben
Anders sein als Chance – wie der SC Freiburg für die 50+1-Regel kämpft.
Die große Mehrheit der Fußballfans will unbedingt an der 50+1-Regel festhalten. 86,7 Prozent der Anhänger aller Vereine wollen die Klausel bewahren, hat ein Nürnberger Marktforschungsinstitut in einer repräsentativen Studie ermittelt, die auf der Befragung von fast 6.000 Personen beruht und Ende 2016 im Magazin Sponsors veröffentlicht wurde. Dennoch gibt es aus dem offiziellen Fußball heraus kaum einmal Bekenntnisse zu ihrem Erhalt. Und wenn, dann sind es allenfalls staatstragende und mehr oder weniger nichtssagende Plädoyers für den Erhalt des Status quo. Doch um Strukturkonservatismus geht es nicht mehr. Die 50+1-Regel ist akut bedroht, es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis der Klageweg nach Luxemburg beschritten werden kann, wo die Entscheidung offenbar bereits feststünde – zumindest läge sie in der Logik der freien Märkte, dem Heiligen Gral der EU-Ideologen. Wenn die 50+1-Regel also wirklich Bestand haben soll, dann müsste jetzt politischer Druck erzeugt werden. Und zwar öffentlich. Doch weder aus der Branche und schon gar nicht aus den Verbänden hört man kämpferische Plädoyers oder gar Forderungen an die Politik – mit zwei Ausnahmen.
Da wäre zum einen FC-St.-Pauli-Manager Andreas Rettig, die andere kritische Stimme ist die von Christian Streich. Freiburgs Trainer nimmt bekanntlich auch dann kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, vor der AfD oder dem Front National zu warnen. Kein Wunder also, dass er sich schon gar nicht den Mund verbieten lässt, wenn es das ureigene Interesse des SC Freiburg tangiert, des Vereins also, für den er seit über 20 Jahren arbeitet. »Es geht darum, das Spiel vor der vollständigen Kommerzialisierung zu schützen, damit das Geld nicht irgendwann – symbolisch gesprochen – über dem Spielfeld liegt und das Spiel und die Menschen, die es lieben, gar nicht mehr erkennbar sind. Deshalb verstehe ich nicht, dass 50+1 nicht weiterhin so geschützt wird wie bisher. Ein Verein gehört nicht einem Menschen«, sagte Streich dem Kicker im April 2017 und kritisierte gleichzeitig die Ausnahmeregelungen, die der DFB gewährt hat. »Deutschland hat sportpolitisch in den vergangenen 20 Jahren vieles richtig gemacht. Deshalb kommen die Fans noch ins Stadion, deshalb gibt es diese Nähe und Konkurrenzsituation. Künftig greift 50+1 nicht mehr bei Vereinen wie Hoffenheim oder Hannover. Diese Ausnahmeregelung halte ich persönlich für falsch und sehr bedenklich.«
Gefördert wird die Vereinzelung der Menschen
Streich sagt solche Sätze, weil sie seiner Überzeugung entsprechen. Ihn stört etwas sehr viel Grundsätzlicheres an der derzeitigen Entwicklung im Fußball als Anastacia-Auftritte in der Halbzeitpause oder Sponsorentermine, die ihn an der Arbeit mit der Mannschaft hindern. Ihn stört, dass der Fußball zunehmend das verliert, was für Streich das Wesen dieses hierzulande so populären Sports ausmacht. Fußball, das hat Streich schon oft im kleinen Kreis recht vehement ausgeführt, ist für ihn ein Gemeinschaftserlebnis. Man schaut ein Spiel gemeinsam mit Freunden, mit gleichgesinnten oder gegnerischen Fans, diskutiert darüber und wechselt auch mal das Thema. Man verbringt Zeit zusammen, Zeit, für die der Fußball äußerer Anlass ist. Kein Wunder missfällt ihm die Dynamik der Pay-TV-Ära, die darauf zielt, für Kneipenwirte das Public Viewing zunehmend unerschwinglich zu machen, die Spieltage immer weiter zu zersplittern und mit all dem nur dafür zu sorgen, dass sich immer mehr Menschen immer mehr Spiele vor dem heimischen Fernsehgerät anschauen. Vereinzelt, als Chips futternde Konsumenten statt in der Gemeinschaft.
Und noch etwas missfällt Streich: die Geringschätzung des Worts »Verein«, die aus den Reden derer herausklingt, die sich »Modernisierer« nennen und eigentlich nur wollen, dass wirtschaftlichen Interessen noch weiter nachgegeben wird. Natürlich kann man einen Verein ins Lächerliche ziehen – mit seiner Satzung, seinen doch oft wichtigtuerischen Funktionären und Kassenwarten. All das assoziieren ja viele zu Recht mit dem Wort »Verein«.
Streich denkt dabei eher an eine soziale Heimat für Menschen, an den Stolz, den er empfand, als er als Teenager aus dem kleinen Örtchen Eimeldingen zum (damals) großen Freiburger FC wechselte. Er denkt an die unzähligen Jugendspieler, die in der Fußballschule von ihm und seinen Kollegen trainiert wurden und die etwas mitbekommen haben vom Leben in einer Gemeinschaft. Und, ja, ein Verein hat auch etwas Politisches. Die Kinder beim SC Freiburg sollen lernen, dass sie Teil einer Gemeinschaft sind, dass der Ellenbogen nicht das wichtigste Körperteil ist – und dass diese Erkenntnis auch gilt, wenn irgendwann mal ein Jugendtrainer einem 17-Jährigen sagen muss, dass es trotz aller Mühe nicht für den Profifußball reichen wird. Die Jugendlichen sollen mitbekommen, dass Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, und mit ihnen in einer Mannschaft spielen.
Doch der Trainer des SC Freiburg ist nicht nur aus ideellen Gründen für den Beibehalt der 50+1-Regel. Er ist auch dafür, weil er Trainer des SC Freiburg ist und damit eines Vereins, der zu den ersten Opfern einer weiteren Öffnung für Fremdkapital gehören würde. »Schützt man den Fußball nicht genug, wird der SC Freiburg entweder nicht mehr in der 1. und 2. Liga spielen, oder es ist nicht auszuschließen, dass sich auch bei uns Investoren beteiligen«, weiß Streich. »Wobei auch das nicht immer den erwarteten Erfolg garantiert, wie man an einigen Klubs sieht.«
Was er meint: In der Saison 2016/17 hat der Sport-Club viel Lob dafür bekommen, wie er es mit dem drittniedrigsten Etat der Liga auf Platz sieben schaffte und damit Branchengrößen wie Schalke, Wolfsburg, Leverkusen oder Gladbach hinter sich ließ. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass das in den nächsten Jahren wohl nicht mehr gelingen wird – auch im 50+1-Land schießt natürlich Geld die Tore. »Der Fußball ist ein riesiges Feld, dem eine enorme Bedeutung beigemessen wird. In den vergangenen 15 bis 20 Jahren ist das exponentiell nach oben geschossen. Im Fußball kann man sich zeigen, da wird man gehört, hat wirtschaftliche Synergieeffekte und ist zeitgemäß«, weiß der Freiburger Coach. Deshalb würden auch weiterhin »viele Leute in den Fußball drängen, die das Spiel nicht lieben, sondern das aus rein wirtschaftlichen Gründen tun. Das wird weiter voranschreiten, es sei denn, es gibt sportpolitische Einschränkungen.«
Der Siegeszug des Modells RB Leipzig
Doch noch können Vereine wie Freiburg, Mainz oder Augsburg mithalten und Ausreißer nach oben landen, wenn sie ihrer Linie treu bleiben, jeden Euro einfach ein paarmal öfter umzudrehen als die Großen, um das Risiko bei Transfers zu minimieren. Wenn sie gut ausbilden und so immer wieder Transferüberschüsse erzielen. Und wenn sie ein Klima schaffen, in dem der eine oder andere Leistungsträger vielleicht doch länger bleibt und erst ein Jahr später zu dem Verein wechselt, der mehr bezahlt.
Wenn 50+1 fällt, werden die genannten Vereine allerdings kaum noch eine Chance haben, sich im bezahlten Fußball zu halten. Denn die Tendenz, die sich jetzt schon bemerkbar macht, wird sich potenzieren. Bereits