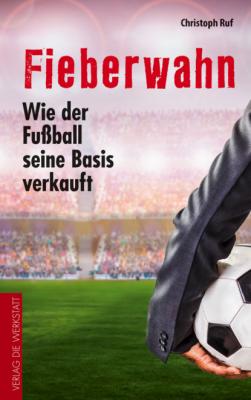ТОП просматриваемых книг сайта:
Fieberwahn. Christoph Ruf
Читать онлайн.Название Fieberwahn
Год выпуска 0
isbn 9783730703601
Автор произведения Christoph Ruf
Жанр Сделай Сам
Издательство Bookwire
Denn der deutsche Fußball steht vor ganz anderen Herausforderungen, national wie international. Die mediale Revolution, weiß man in Frankfurt, wird auch diesmal wieder den Fußball verändern. Schon bei der Einführung der Fußballbundesliga 1963 war das Fernsehen ein wichtiger Akteur – und letztlich der Schrittmacher der kommerziellen Entwicklung. In den letzten 50 Jahren ist die wechselseitige Abhängigkeit stetig gestiegen. Bis zum heutigen Punkt, an dem eigentlich niemand mehr bestreiten kann, dass so gut wie alle elementaren Aspekte des Sports nach dem Kriterium der TV-Tauglichkeit gestaltet werden.
Warum das so ist, kann niemand besser erklären als der Berliner Philosophieprofessor Gunter Gebauer. In seinem Buch Das Leben in 90 Minuten schreibt er: »Die serielle Erregung der Fußballspiele überlagert die Alltäglichkeit der Arbeitswoche. Die Routine des Lebens wird von einem Fest in Permanenz eingerahmt. Durch den Fußball hat das Fernsehen eine Dimension gewonnen, die weit über seine gewöhnlichen Sendungen hinausgeht. Es zeigt eine Wirklichkeit, die nach normalen Maßstäben unwahrscheinlich ist, aber durch seine Bilder die Botschaft vermittelt: Was du jetzt hier siehst, geschieht wirklich! In der mit Fiktionen vollgestellten Fernsehlandschaft erscheinen die Spielberichte, neben der Tagesschau und Heute, als letzte Botschaften aus der wirklichen Welt.«
Verlierer des globalen Wettrennens
So mancher Vertreter von Vereinen und Verbänden weist auf eine weitere Parallele zu den 1960er Jahren hin. Schon damals seien genau zu dem Zeitpunkt, als sich mit Einführung der Bundesliga die damals modernen Medien durchsetzten, zahlreiche Traditionsvereine wie Westfalia Herne oder Borussia Neunkirchen von der großen Bühne verschwunden. Es deute vieles darauf hin, dass der Fußball im Moment wieder auf eine ähnliche Entwicklung zusteuere. Das Gefühl, dass sich im Fußball gerade wirklich etwas Grundsätzliches verändert, haben also nicht nur die Fans, sondern auch die Offiziellen.
Wobei es einen entscheidenden Unterschied zu den Zeiten des Schwarz-Weiß-Fernsehens gibt. Natürlich gab es auch in den 1960er Jahren Vereine, die nach der gescheiterten Qualifikation für die Bundesliga den Anschluss an die Moderne verpassten und sich davon seither nicht mehr erholt haben. Doch das waren Einzelfälle, deren Abstürze wenig mit systemischen Gründen und viel mit Misswirtschaft zu tun hatten. Heute droht sehr vielen Vereinen der Absturz – nämlich all denen, die vom Fernsehgeld abgeschnitten sind, und all denen, die nur noch die Rücklichter der Großen sehen.
Denn heute klaffen im deutschen Fußball gleich mehrere Lücken – zwischen einzelnen Ligen, aber auch innerhalb der 1. Liga. Und beides hat nichts damit zu tun, dass die Manager der jeweils Abgehängten hinter dem Mond leben würden und die wichtigen Entwicklungen verschlafen hätten. Es hat schlicht strukturelle Gründe. Dass die Großen noch größer werden, ist die logische Folge der Politik seit einigen Jahren: Es sind die Champions-League-Vereine, die deutlich überproportional von den Fernsehgeldern profitieren. »Die Bundesliga war doch nur deshalb so erfolgreich, weil die Digitalisierung nach Content verlangte und es keinen besseren Content gibt als Fußball«, sagt ein Verbandsvertreter. Und führt den Gedanken weiter aus: Wenn die Digitalisierung weitergehe, und das wird sie, könnten auch bald Premier-League-Spiele live in Deutschland einem Massenpublikum gezeigt werden, also im Hauptprogramm und nicht wie bisher bei DAZN. Die technische Entwicklung würde es möglich machen, dass der deutsche Fernsehzuschauer dabei auf ihn zugeschnittene Werbebanden sieht, während der Zuschauer in Liverpool oder London selbst auf die Originalbanden schaut. Gut möglich also, dass sich deutsche Großbrauereien oder Baumärkte, die derzeit noch die Banden zwischen Hamburg und Dresden bestücken, dann fragen, ob sie das Geld nicht lieber in Liverpool als in Leverkusen investieren sollen. Kein unlogischer Gedanke, wo doch die Kids heute auch in Leverkusen mit United- und PSG-Trikots zum Bolzen gehen. Das wäre, so raunt der offizielle Fußball, Geld, das der Liga dann fehlen würde.
Nun wird klar, was gemeint war mit dem Satz am Anfang, wonach man sich nicht auf den eigenen Lorbeeren ausruhen dürfe. Also muss die Liga weiter expandieren, immer bessere TV-Verträge abschließen, um den Abstand zu den Engländern nicht noch größer werden zu lassen. Doch da der nationale Fernsehmarkt schon annähernd gesättigt ist – und einen noch höher dotierten Vertrag dürfte Sky nicht mehr abschließen wollen oder können –, sind die einzigen Märkte, die weiteres Wachstum versprechen, in fernen Ländern.
Zum Beispiel in Japan und in China. Genau das ist der Grund, warum Schalke, Bayern und Dortmund große Teile ihrer Sommervorbereitung auch 2017 nach Fernost verlegten. Alle drei wählten dabei Reiserouten um die 20.000 Kilometer, der BVB unternahm von China aus gleich noch einen Abstecher nach Tokio. Dabei ist die Saisonvorbereitung jedem Profitrainer der Welt eigentlich heilig. Einen Fehlstart in die Saison will man unbedingt vermeiden, von den konditionellen Grundlagen, die im Sommer gelegt werden, zehrt man im Idealfall bis zum Saisonende. Da wird schon mal das Hotel gewechselt, wenn sich der vorher von der eigenen Delegation als Teppich angepriesene Rasen doch als nicht ganz so toll erweist. Journalisten dürfen keinesfalls im gleichen Hotel übernachten, der Essensplan ist strikt, über die Einhaltung der Nachtruhe wird streng gewacht. »Optimale Bedingungen« müssen es sein. Keine Wendung hört man im Juni und Juli öfter von Trainern und Managern.
Von optimalen Bedingungen ist man in Shanghai oder Hongkong allerdings weit entfernt, bereits die Luftverschmutzung ist legendär. Hinzu kommen Temperaturen um die 40 Grad, der Jetlag nach geschlagenen 10.000 Kilometern Anreise, die extrem hohe Luftfeuchtigkeit von rund 90 Prozent. Kurzum: Die Bedingungen sind alles in allem so weit weg vom Optimum, dass der damalige Schalke-Trainer Markus Weinzierl laut Kicker 2016 in geschlossenen Hotelräumen trainieren ließ. Doch darum geht es auch gar nicht, denn die Reisen sind nur ein sehr langer, sehr kostspieliger, sehr strapaziöser PR-Termin. Die konditionellen Grundlagen und der Feinschliff stehen nach der Rückkehr aus Fernost auf dem Programm.
»Die neuen Märkte beackern«
Kein Manager würde all das in Kauf nehmen, wenn er nicht ganz sicher wäre, dass es sich x-fach lohnt. Und es lohnt sich ja auch, zumindest in der Perspektive, in der heute im Fußball gedacht wird. Für die Großen geht es höchstens noch als kurzfristiges Ziel darum, den Meistertitel im nationalen Wettbewerb zu holen, und selbst ein Champions-League-Gewinn ist nur ein Etappenziel. Worum es eigentlich geht, ist, eine weltweit dominierende Marke aufzubauen. Deswegen leisten sich Real Madrid und Barcelona Ronaldo und Messi, und weil sie sich die beiden leisten, ist wiederum die spanische Liga eine Marke (hier passt der Begriff mal), die mit der Premier League und der Bundesliga Schritt hält. Deswegen kaufen manche Vereine extra Spieler aus Fernost, um die Aufmerksamkeit in deren Heimatland auf sich zu lenken. Deswegen unterhält der FC Bayern Büros in Shanghai und New York, und deshalb muss Uli Hoeneß nicht lange überlegen, wenn er gefragt wird, warum sein Team strapaziöse Asienreisen auf sich nimmt: »Wenn Sie die großen Mannschaften auf diesem Planeten – Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City – betrachten: Die sind alle unterwegs. Wenn du die neuen Märkte beackern willst, dann musst du da hin.« Man mag schlucken bei solchen Aussagen, die, wenn man sie isoliert liest, auch von Managern stammen könnten, die Autos oder Limonade statt Fußball verkaufen.
Doch Uli Hoeneß hat schlicht und einfach recht. Die genannten Vereine sind längst globale Marken, deren Insignien am Strand von Ko Samui genauso getragen werden wie im Yellowstone-Nationalpark oder in Kapstadt. Tausende Japaner, angefixt von ihren Fernsehkanälen, kaufen Trikots und Schals aus Vorfreude auf die seltsame Mannschaft aus Deutschland mit dem noch seltsameren Namen Schalke 04, bevor sie sich deren Spiele in Shanghai anschauen. Und selbstredend fliegt eine globale, interkontinentale Elite gerne zu den Heimspielen von PSG, ManCity oder Liverpool und deckt sich dort mit den neuesten Trikots von Neymar oder Firmino ein. Wer diese Vereine in all ihrer Unterschiedlichkeit vor 20 Jahren erlebt hat oder gar ihr Fan ist, dürfte traurig und wehmütig darüber sein, wie aus charismatischen Klubs, die immer wieder auch Ausdruck des Lebensgefühls in ihren Städten waren (und deren Probleme reflektierten), austauschbare Fußballkonzerne für den internationalen Konsumenten-Jetset wurden. Aber darf man diese Entwicklung deren Managern vorwerfen? Sie tun das, wofür sie bezahlt werden. Sie melken die Kühe, die auf der Weide stehen. Und die Kühe werden immer mehr.
Kein Wunder