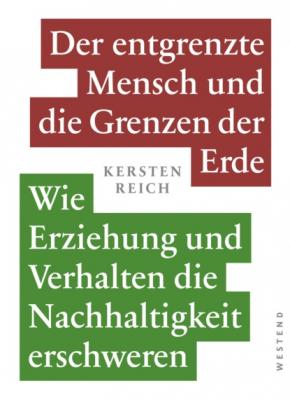ТОП просматриваемых книг сайта:
Der entgrenzte Mensch und die Grenzen der Erde Band 1. Kersten Reich
Читать онлайн.Название Der entgrenzte Mensch und die Grenzen der Erde Band 1
Год выпуска 0
isbn 9783864898235
Автор произведения Kersten Reich
Жанр Изобразительное искусство, фотография
Издательство Bookwire
Um sich den Gründen für diese Entwicklungen anzunähern, ist es sinnvoll, sich die Unterscheidung zwischen den Begriffen Nachhaltigkeit (sustainability) und nachhaltige Entwicklung (sustainable development) klarzumachen. Viele Menschen wollen beide miteinander verbinden, um ihre bisherige Lebensweise nicht gänzlich infrage stellen zu müssen9:
Einerseits ist Nachhaltigkeit nur mit radikalen Verhaltensänderungen zu erreichen. Die Umwelt müsste unabhängig von den menschlichen Bedürfnissen und Wohlstandserwartungen so geschützt werden, dass ein Einhalten des 1,5-Grad-Ziels und vieler anderer Begrenzungen mehr gewährleistet werden, um das langfristige Leben auf der Erde nicht zu gefährden. Aber solche Ziele erscheinen immer stark auslegbar und schwer greifbar, weil die Veränderungen langsam einsetzen und oft erst nach Erreichen der Gradgrenzen spürbar werden. Ob ein oder zwei Grad sinnvoller für das Aufhalten schädlicher Umweltwirkungen sind, das zeigt erst die Zukunft. Zudem ist gegenwärtig nicht erkennbar, wie diese Ziele überhaupt erreicht werden sollen. Zu den bereits erwähnten gibt es viele weitere nachhaltige Ziele, die gegenwärtig ebenfalls verfehlt werden; ich werde weiter unten noch näher darauf eingehen.
Andererseits gibt es den Wunsch nach einer nachhaltigen Entwicklung: So unterstellen nationale und internationale Gremien als Vertretungen der Menschheit, eine Mehrheit wolle, dass der erreichte Wohlstand und das bisherige Leben im Überfluss dadurch weitergelebt und fortgeschrieben würden, dass der wissenschaftlich-technische Fortschritt die Lücke zwischen notwendiger Begrenzung und steigendem Wohlstand schließt. Die Erwartung, dass dies gelingen kann und muss, ist übergroß, der Zweifel an diesen Anspruch ist verhältnismäßig gering. Insbesondere die Politik der reichen Länder scheut hier jeglichen Zweifel, weil er die Wirtschaft schwächen und direkt Wählerstimmen für alle Parteien kosten könnte. »Die Diskrepanz zwischen dem Wissen über die ökologische Krise und der Effektivität ihrer politischen Bearbeitung wächst. Institutionen internationaler Umweltpolitik stecken gerade in Zeiten der Verschärfung ökologischer Probleme in einer Legitimationsund Funktionskrise.« (Brand & Wissen 2011, 12)
Der Entwicklungsgedanke ist von der zentralen Annahme geleitet, dass es entweder durch Wirtschaftsinteressen zu einer wissenschaftlich-technologischen Lösung der Umweltfragen oder in einer »grünen Ökonomie« (UNEP 2011) zu einem Ausgleich in sozialer und ökologischer Hinsicht kommen kann. Von sozialer Seite her gesehen, die auch einen Teil von Nachhaltigkeit darstellt, ist es überaus deutlich, dass neben der steigenden ökologischen Problematik eine wachsende Armutskluft zwischen Nord und Süd und selbst innerhalb der einzelnen Nationen vorhanden ist, die die menschliche Zukunft als soziale Lebensform in einer Schieflage zeigen.
Aber diese Doppeldeutung von Entwicklung wird in der herrschenden Ökonomie ganz anders rekonstruiert. Die Wirtschaft mit ihrem Gewinnstreben bei zugleich ungerechter Verteilung hat bisher in den kapitalistischen Strategien immer Vorrang, weil – so die Drohung – ohne sie ohnehin alles zusammenbrechen würde, was Wohlstand und Überfluss auch für die Massen bedeutet. Mit der Steigerung des Wohlstands sollen die Menschen auch bereit sein, ihre soziale Lage zu akzeptieren und wesentliche Kosten für die Ökologie mitzutragen.
Dagegen stehen die weltweiten Armuts- und Reichtumsberichte, die im Gegenteil zeigen, wie ungleich und ungerecht der Reichtum der Welt verteilt ist. Zudem hat die Umweltforschung nachgewiesen, dass die Reichen in der Welt deutlich mehr zur Schädigung beitragen als die Armen (Oxfam 2020): Von 1990 bis 2015 haben die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung mehr als doppelt so viele klimaschädliche Kohlendioxid-Emissionen in die Luft geblasen wie die ärmere Hälfte der Menschheit zusammen. Ein Prozent der Reichen steht für 15 Prozent der Treibhausgase, die ärmere Hälfte der Menschheit gerade einmal für 7 Prozent. Hinzu kommt, dass die Reichen mit ihren SUVs und Flugreisen immer stärker auch ein Vorbild für die Schichten unter ihnen geworden sind.
Nun ist die Frage, welche Handlungen aus diesen Erkenntnissen folgen. Die systemrelevante Ökonomie nimmt die Forderungen der Nachhaltigkeitsagenda solange gelassen hin, wie die ökonomische Entwicklung im Vordergrund der Agenda steht. Einige fordern sofortige Handlungen, um die Wirtschaft ökologischer auszurichten (etwa Stern 2006, 2016). Und was für die soziale Frage schon lange gilt, das verschärft sich für die Ökologie noch, denn die Kosten sollen möglichst alle tragen, die Gewinne möglichst wenige machen. Vor diesem Hintergrund wird Entwicklung zu einer Art Mythos, der die gegensätzlichen Kräfte der sozialen Gerechtigkeit und der wachsenden Ökonomie mit Gewinnstreben scheinbar gut vereinen kann.
Und die Politik? Weder massenwirksame Beschreibungen wie der Film An Inconvenient Truth von Al Gore noch die ständigen Sachstandsberichte des Intergovernmental Panel on Climate Change (Weltklimarat, mittlerweile bis 2022 in der sechsten Berichterstattungsphase) oder zahlreiche Forschungsergebnisse, Sachbücher und Medienberichte oder Demonstrationen wie die Fridays for Future haben, obwohl die Einsicht in die Gefahr insbesondere der fossilen Brennstoffe für den Klimawandel gewachsen ist, dazu geführt, dass tatsächlich radikal umgesteuert wird. Es »weisen immer mehr Studien darauf hin, dass es zwar ein zunehmendes Wissen über die vielfältigen lokalen, regionalen und globalen Dimensionen der ökologischen Krise in den unterschiedlichsten Feldern wie Klimawandel, Erosion der biologischen Vielfalt oder Wasserknappheit gibt. Gleichwohl führen diese Einsichten kaum zu weit reichenden Politiken und schon gar nicht zu deren Implementierung« (Brand & Wissen 2011, 13).
Nachhaltigkeit ist ein Grenzbegriff, der stets zur Diskussion stellt, ob die Folge einer Handlung für das spätere Leben nachhaltig ist oder nicht (historisch vgl. Caradonna 2014). Es wird hier immer öffentlich, politisch, in Lobbygruppen, durch Protest und Widerstand, in sozialen Gruppen wie von einzelnen Menschen bestimmt, inwieweit Nachhaltigkeit der Erhalt eines bestehenden und für »gut« gehaltenen Zustandes sein soll oder ob eine verträgliche Weiterentwicklung im bisherigen Lebensstandard möglich erscheint. Hierbei richten sich die subjektiven Meinungen und Beurteilungen sehr stark nach selektiven Interessenlagen, menschlichen Wünschen auf Selbstverwirklichung und unzähligen Konsumwünschen.
Die eingenommenen Standpunkte sind sehr unterschiedlich: Es gibt die naturwissenschaftliche Sicht, etwa zu den Zuständen des Klimas, des Wassers, der Ressourcen usw. Einen weiteren Zugang bilden soziale, ökonomische und politische Studien, die das Verhältnis von Nachhaltigkeit zur menschlichen Wirtschafts- und Lebensweise vielfältig diskutieren. Eine besondere Rolle spielen außerdem philosophische, kulturbezogene bis hin zu ethischen Überlegungen, die meist einen großen Deutungsrahmen im Kontext der Kulturgeschichte aufbauen. Politisch-ökonomische Diskurse verbinden die ökologische Kritik mit einer Kapitalismuskritik. Der öffentliche Diskurs in den Medien und Regierungserklärungen wird insbesondere durch die UN und ihre Unterorganisationen wie auch einige führende Nichtregierungsorganisationen bestimmt. Hieraus hat sich ein Feld der politischen Ökologie entwickelt, in dem sich unterschiedliche Interessengruppen sammeln (vgl. etwa Peet et al. 2011, Perreault et al. 2015, Bryant 2015, Swyngedouw & Wilson 2014).
Insgesamt beschleunigt sich durch die Vielzahl der Ansätze in wissenschaftlichen Fachpublikationen und Fachgesellschaften – insbesondere in den Naturwissenschaften – eine wissenschaftliche Beurteilung, die zu einer Versachlichung beitragen kann, weil sie etwa nachweisbare Veränderungen und Kipp-Punkte bestimmt, die all die Subjektivierungen der politischen Interessengruppen objektivieren helfen. Ob dies dann wiederum dazu führen kann, die Menschen – und hier vor allem die Politik – eines Besseren zu belehren, das ist allerdings eine ganz andere Frage. Hieran bestehen deshalb große Zweifel, weil eine Wirkung der schon bestehenden wissenschaftlichen Datenlage bisher in ausreichender Weise ausgeblieben ist. Es stellt sich so die Frage, ob dies überhaupt durch Argumente gelingen kann oder ob erst größere Katastrophen oder Kipp-Punkte einsetzen müssen, um die Mehrheit der Menschen zu einer Berücksichtigung der Grenzen des Wachstums und zu nachhaltigem Handeln zu bringen.
Wenn diese Kipp-Punkte aber