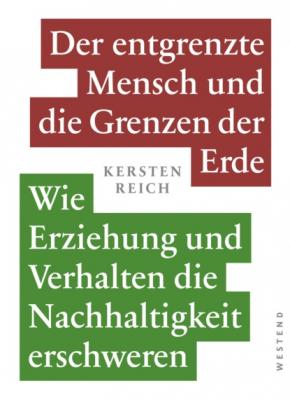ТОП просматриваемых книг сайта:
Der entgrenzte Mensch und die Grenzen der Erde Band 1. Kersten Reich
Читать онлайн.Название Der entgrenzte Mensch und die Grenzen der Erde Band 1
Год выпуска 0
isbn 9783864898235
Автор произведения Kersten Reich
Жанр Изобразительное искусство, фотография
Издательство Bookwire
Abschließend wird diskutiert, was die Forschung uns konkret über die Chancen und Grenzen menschlicher Verhaltensänderungen lehrt. Dabei hat sie insbesondere Barrieren der Verhaltensänderung aufgewiesen, die uns sehr klar zeigen, wie schwierig es überhaupt ist, ein einmal angeeignetes Verhalten und Gewohnheiten zu ändern. Die Lösungen, die uns bleiben, erscheinen vielen noch als unendlich groß, anderen bereits als unendlich klein, aber so vielfältig sie auch im individuellen Fall sein oder erscheinen mögen, so radikal werden sie im großen Maßstab erfolgen müssen, damit sie nicht zu spät kommen.
Teil IV, in dem mögliche Auswege aus den Nachhaltigkeitsfallen erörtert werden sollen, wendet sich der Erziehung und Bildung zu. Bei gelingender nachhaltiger Erziehung scheint die Chance groß, Nachhaltigkeit tatsächlich verstehen und umsetzen zu können. Aber die Analyse der gegenwärtigen Erziehung und der Vorstellungs- und Denktradition zeigt im Gegenteil auch, wie statt einer möglichen Lösung ein anderes großes Problem vorliegt. Um nachhaltig erziehen zu können, müssten die Erziehenden selbst schon erzogen sein, müsste eine radikale Erziehungs- und Bildungsreform Voraussetzungen für einen Erfolg schaffen. So wie die Frage offen ist, ob nicht auch die soziale Gerechtigkeit verbessert werden müsste, bevor die Nachhaltigkeit besser gelöst werden kann, so bleibt auch die Frage, ob nicht Erziehung und Bildung völlig neu aufgestellt werden müssten, bevor wir erwarten können, dass sie das menschliche Verhalten in Richtung auf Nachhaltigkeit verbessern könnten.
Das Erziehungssystem hat durch die Trennung von Familie und Schule zwei unterschiedliche Autoritätsinstanzen und Verantwortlichkeiten errichtet, die fast alle Fragen des sozialen Lebens und der Verantwortung auch bezüglich der Nachhaltigkeit der Familie und dem jeweils vorhandenen Bildungsstand – aus dem dann auch die grundlegende Einstellung zur Nachhaltigkeit hervorgeht – überlässt. Mit diesem Vorgehen soll einer Neutralität der weltanschaulichen Beeinflussungen entsprochen werden, in der Raum für die Diversität einer pluralen Gesellschaft bleibt. Alle sollen sich eine eigene Meinung bilden können, was natürlich sowohl Raum für Nachhaltigkeitsbefürworter wie für ihre Gegner lässt.
Wie nehmen im Gegensatz zum Erziehungssystem Familien das Problem der Nachhaltigkeit auf? Die meisten Familien sehen heute die Nachhaltigkeit als Sorge im eigenen Leben vorrangig als Aufgabe ihrer sozialen Sicherung. Hier werden Einstellungen, Werthaltungen, Sorgen und Ängste tradiert. Der Staat hingegen ist, vertreten durch das Schulsystem, eher eine Verteilungsinstitution, die durch Benotung und Beurteilung die Abschlüsse regelt, die Aufstiege und Aufrückungen im gesellschaftlichen Leben klärt, gesellschaftlich wichtige Themen und Inhalte vermittelt, aber deren Priorisierung den Heranwachsenden überlässt. Dabei setzt der Staat auf zwei Beharrungskräfte: Einerseits auf die Tradition der Familien, insbesondere auf den Wunsch, ehemals erfolgreiche Modelle von Werten und Normen sowie Einstellungen und Verhaltensweisen zu bewahren. Andererseits auf die politisch dominanten Kräfte, die das Schulsystem gestalten und als Bürokratie der Bestimmung von Lebenswegen vorhalten. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Ideologie einer gleichen Behandlung unterschiedlicher Individuen mit günstigen oder ungünstigen Bildungsvoraussetzungen, denen mit gleichen Anforderungen und kostensparender Vorgehensweise im one-size-fits-all begegnet wird, erhält bloß die schon erreichten Besitzstände, sowohl was den Wohlstand als auch was die Bildung betrifft. Sie gibt sich stets neutral, obwohl sie Partei für die Stärkeren ergreift. In der Nachhaltigkeit ist dies ein ungünstiger Ausgangspunkt, denn obgleich die staatliche Erziehung und Bildung im Sinne einer ausgleichenden Vernunft zu wirken fähig wäre, hat sie sich stattdessen von Anfang an der Bewahrung bestehender Praktiken, Routinen und Institutionen ergeben. Ihre Aussage lautet stets: An bestehenden Strukturen und Verhaltensweisen wollen wir im Grunde nichts verändern.
Obwohl heute viel von einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) oder radikaler von einem Lernen für Nachhaltigkeit gesprochen wird, so ist eine solche Erziehung und Bildung bisher weder verbindlich im deutschen Schulsystem noch umfassend in der Bildungspolitik verankert. Die heutige Bildung bereitet die Menschen eher auf einen negativen Fußabdruck vor, der immer größer wird, als auf einen positiven Handabdruck, der die Grenzen des Wachstums respektiert und das Verhalten tatsächlich umfassend ändert.
Schon länger als der Kampf um mehr Nachhaltigkeit währt der Kampf um stärkere soziale Gerechtigkeit. Ein internationaler Vergleich der Schulsysteme zeigt, dass es beispielsweise den skandinavischen Ländern deutlich besser als Deutschland gelingt, auch bildungsbenachteiligte Gruppen erfolgreich werden zu lassen. In Schweden haben Heranwachsende aus bildungsbenachteiligten Milieus fünfmal höhere Chancen ein Abitur zu machen als in Deutschland. In keinem entwickelten Land ist der Bildungserfolg so stark von der Herkunft abhängig wie bei uns. Würden wir dieses politische und staatliche Versagen als Vorhersage für das Gelingen einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung nehmen, dann sind die Prognosen schlecht. Die in Deutschland lange schon aufgeschobene und abgewehrte »Bildungsrevolution«, die eine Übernahme etwa des erfolgreichen skandinavischen Modells bedeuten würde, wäre eine wesentliche Bedingung dafür, dass Nachhaltigkeit im deutschen Schulsystem überhaupt hinreichend vermittelt werden könnte.
Abschließend beschreibe ich, dass es zwei Argumentationen gibt, die beide häufig anzutreffen sind: Es sollen jene beim Wort genommen werden, die behaupten, dass es immer »weiter so« gehen soll, weil die Krise entweder übertrieben wird oder ohnehin gar nicht aufzuhalten ist. In dieser Sicht können sich Befürworter oder Leugner der Krise sogar einig fühlen. Dagegen mögen die Ausführungen den Optimisten Hoffnung geben, die niemals aufgeben wollen. Sie wissen, dass jede und jeder bei sich selbst anfangen muss, denn Nachhaltigkeit kann nicht einfach nur allgemein verordnet und instruiert werden, sondern bedarf der aus Einsicht erwachsenen und emotional vertretenen individuellen Handlung. Alle müssen sich Gedanken darüber machen, was gut funktioniert und was weniger gut gelingen kann. Die große ökologische und nachhaltige Transformation wird auch nicht ohne Verzicht zu vollziehen sein. Sie kann durch Innovationen und neue Lebenskonzepte kompensiert werden, sie kann sogar die Menschheit sozial gerechter machen und sich vielfältig in neue Richtungen entwickeln lassen, aber zunächst bedeutet sie eine wesentliche Umstellung in sehr vielen Lebensbereichen. Einige Eckpunkte für das Vorstellen, Denken und Verhalten, die für ein solches Umdenken nötig sind, will ich in den Blick nehmen.
Ich beende die Argumentation mit individuellen Regeln für ein nachhaltiges Verhalten, die ich aus einer Sichtung sehr vieler Vorschläge aus der Literatur verdichtet habe. Würden wir sie als Leitfaden für nachhaltiges individuelles Handeln nehmen, dann wären wir einen großen Schritt weiter. Sie werden im zweiten Band durch gesellschaftliche Regeln ergänzt.
Mein Dank gilt den vielen Forscherinnen und Forschern, die mir ihre Veröffentlichungen frei zugänglich gemacht haben. Die umfangreichen Referenzen finden sich im Literaturverzeichnis für beide Bände, das mit Links zu zugänglichen Quellen auch online unter www.westendverlag.de/nachhaltigkeit verfügbar ist. Es sind zu viele, die mich in meinem Vorhaben unterstützt haben, um sie hier einzeln zu nennen. Hervorheben will ich die Lektorin Lea Mara Eßer vom Westend Verlag, die durch ihre professionelle Überarbeitung zur Verbesserung des Textes beigetragen hat.