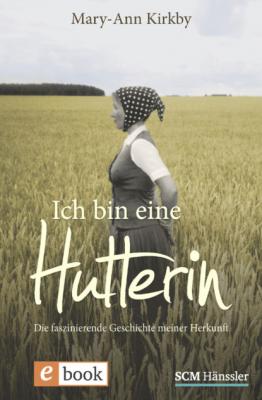ТОП просматриваемых книг сайта:
Ich bin eine Hutterin. Mary-Ann Kirkby
Читать онлайн.Название Ich bin eine Hutterin
Год выпуска 0
isbn 9783775173742
Автор произведения Mary-Ann Kirkby
Жанр Документальная литература
Издательство Bookwire
Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit fiel Mary-Ann wirklich nicht immer leicht, doch sie half ihr, besser zu verstehen, wer sie heute ist. Ihre unsagbar ergreifende Schilderung ist Balsam für die Seelen aller, die Spott und Ablehnung erfahren haben, denn sie unterstreicht, dass nicht unsere Kleidung, nicht unsere Lieder und nicht die Menschen in unserem Umfeld bestimmen, wer wir sind, sondern etwas tief in unserem Herzen.
Anfangs meinte ich, die Arbeit wäre mit Beendigung des Buches abgeschlossen, doch jetzt weiß ich, dass die wirkliche Chance für Veränderung in der Zukunft liegt. Als Jakob Hutter die hutterische Kirche gründete, gehörte zu seiner Vision eine Welt ohne Gewalt, in der alles geteilt wird. Ich hoffe, dieses Buch erinnert uns daran, dass wir alle zur Menschheitsfamilie gehören und dass wahrer Friede ohne Furcht und Verurteilungen, aber mit Liebe, gegenseitiger Annahme und Mitgefühl erreicht werden kann.
A.G.
Arvel Gray wohnt in Winnipeg und ist Autorin und Rundfunksprecherin sowie Geschäftsführerin von »Waking the World«, einem Projekt, das Frauen weltweit zusammenbringt und eine Stimme verleiht.
Eine kurze Geschichte der Hutterer
Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren.
Apostelgeschichte 2,44-45
Der hutterische Glaube nahm seinen Anfang im sechzehnten Jahrhundert, als Jakob Hutter, ein österreichischer Hutmacher, eine kleine Gruppe von Wiedertäufern zu einer neuen Art christlicher Gemeinschaft zusammenführte. Auf einem staubigen Pfad in Mähren legten im Jahr 1528 eine Handvoll Flüchtlinge aus Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz eine einfache Decke auf den Boden, auf die sie alle ihren Besitz legten, sogar das, was sie in den Taschen hatten. Das war der Beginn unserer Geschichte.
Nach dem Vorbild der Urgemeinde in Jerusalem lebten sie ihren Glauben so, wie es im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte in den Versen 44 und 45 beschrieben ist: »Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren.« Hutters begeisterte Vision von einer Gesellschaft, in der aller Besitz geteilt wird und die Menschen zum Wohl aller zusammenarbeiten, führte zur Gründung der hutterischen Kirche und der hutterischen Lebensweise. Doch seine Lehre von einem Leben in Gemeinschaft, der Erwachsenentaufe und des Pazifismus rief den Hass und die Intoleranz des Staates und der vorherrschenden Religionen hervor, und die Hutterer mussten fast vierhundert Jahre lang in Europa von einem Land zum anderen fliehen.
1536 wurde Hutter in Innsbruck auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil er sich weigerte, seinem Glauben abzuschwören. Er teilte somit das Schicksal vieler unserer Vorväter. Doch einige überlebten und fanden 1770 Zuflucht in der Ukraine, bis ihre Befreiung von der Wehrpflicht widerrufen wurde und sie beschlossen, in die Vereinigten Staaten auszuwandern.
Am 5. Juli 1874 kamen die Hutterer an Bord der Hammonia aus Russland in New York an. Gebeutelt, aber nicht geschlagen waren sie fest entschlossen, ihre Mittel zusammenzulegen und von Neuem zu beginnen. Mein Urgroßvater Jakob Maendel gehörte zu ihnen. Die erste hutterische Kolonie auf nordamerikanischem Boden wurde 1874 am Ufer des Missouri in der Nähe von Yankton in South Dakota gegründet. Für alle Hutterer hat sie heute noch eine besondere geschichtliche Bedeutung und sie ist immer noch in Betrieb.
Im Verlauf des Ersten Weltkriegs zogen ganze hutterische Gemeinschaften nach Kanada, um der Verfolgung als Kriegsdienstverweigerer zu entgehen. Nach dem Krieg erkannte die amerikanische Regierung ihren Wert als Ackerbauer und Viehzüchter und lud sie zur Rückkehr in die Vereinigten Staaten ein. Ein Drittel von ihnen kam dieser Aufforderung gerne nach, doch der Rest blieb in Kanada und gründete neue Kolonien in ganz Westkanada, einschließlich meiner Heimatkolonien New Rosedale und Fairholme in Manitoba.
Mit ihrem Bekenntnis zur Gütergemeinschaft unterscheiden sich die Hutterer von den Amish und den Mennoniten und zeichnen sich als bestes und erfolgreichstes Beispiel des Gemeinschaftslebens in der Neuzeit aus. Heute gibt es ungefähr 45 000 Hutterer, die in vierhundert Kolonien im Nordwesten der Vereinigten Staaten und in den kanadischen Prärien leben.
Einleitung
Im Juli 2002 sprach mich eine Freundin, die Journalistin war, an und fragte, ob ich nicht für eine Zeitschrift einen Artikel über hutterische Gärten schreiben wollte. In Manitoba gibt es über hundert hutterische Kolonien, aber ich wusste genau, welche ich aufsuchen würde. Es war nicht leicht, der Obergärtnerin der Kolonie Fairholme die Idee schmackhaft zu machen. Judy Maendel war nicht davon überzeugt, dass ihr Garten eine Geschichte wert ist.
»Du lieber Himmel, in diesem Jahr haben wir nur einen ganz kleinen Garten.« Sie seufzt am Telefon. »Warum versuchst du es nicht in New Rosedale oder James Valley? Deren Gärten sind so groß, dass sie sogar Gemüse verkaufen.« Aber ich will unbedingt nach Fairholme gehen und lasse nicht locker.
Dicke weiße Wolken, die an die Zeichnung eines Kindes erinnern, stehen am Himmel, der sich über die weite Prärie wölbt, als ich meinen fünfjährigen Sohn Levi ins Auto setze und mich auf die Reise mache. Ich brauche keine Wegbeschreibung. Ich kenne den Weg so gut wie die Stimme meines Sohnes. Die reichen, erdigen Gerüche des Sommers von Manitoba tanzen durch das offene Autofenster, als ich auf der Fernstraße Richtung Westen fahre. Auf beiden Seiten der Autobahn erstrecken sich gelbe Rapsfelder, so weit das Auge reicht.
»Es war einmal …«, beginnt die Robin-Hood-Kassette, die Levi sich herausgesucht hat.
Ja. Es war einmal! Erinnerungen strömen auf mich ein und ich höre fast den Klang der Küchenglocke der Kolonie, die die Frauen zur Arbeit ruft. Ein Traktor mit Anhänger wartet ungeduldig neben einem sandigen Weg, der sich zu den Gärten am Ufer des Flusses Assiniboine hinunterschlängelt. Ich sehe, wie meine Mutter und die anderen Frauen auf die Pritsche des Anhängers steigen, jede mit einem Zehnlitereimer aus Edelstahl für die Ernte des Tages. Ihre charakteristische Kleidung drückt Sicherheit, Pflichtbewusstsein und Mutterschaft aus. Jede hat ein Tiechel auf dem Kopf, ein schwarzes Kopftuch mit weißen, erbsengroßen Punkten. Bei den Frauen ist auch Judys Mutter Sara, die Obergärtnerin. Mit geröteten Gesichtern und verfleckten Fingern kehren sie ein paar Stunden später zurück zum Lunschen, dem gemeinsamen Essen am Nachmittag – die Eimer voll roter Erdbeeren für die Kinderschar, die auf sie wartet. In ihren einfachen Küchen schütten sie die Früchte in Schüsseln und richten sie mit frischer Sahne und etwas Zucker an. Ihre ausgeschlafenen, hungrigen Kinder drängen sich um den Tisch und essen, bis sie fast platzen. Bald wird die Glocke wieder ertönen und die Frauen müssen zur Arbeit zurück. Der größte Teil der Erdbeeren wartet im kühlen Keller der großen Gemeinschaftsküche, bis er zu Kuchen und köstlicher Marmelade verarbeitet wird …Von Winnipeg aus ist es noch eine Stunde Fahrt bis zur Kolonie Fairholme. Eine staubige Schotterstraße, die auf beiden Seiten mit majestätischen Eichen gesäumt ist, führt uns ins Herz von Fairholme, wo bunte Blumengärten den schlichten alten Häusern ein festliches Aussehen verleihen.
Mein Sohn und ich gehen zu Judys Haus. Ihre Schwester