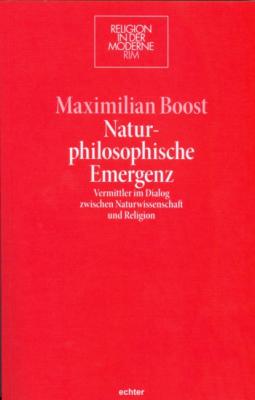ТОП просматриваемых книг сайта:
Naturphilosophische Emergenz. Maximilian Boost
Читать онлайн.Название Naturphilosophische Emergenz
Год выпуска 0
isbn 9783429060459
Автор произведения Maximilian Boost
Жанр Документальная литература
Серия Religion in der Moderne
Издательство Bookwire
6.2 Formulierung des Körper-Geist-Problems
In der vorangegangenen Darstellung zeigt sich ein Widerspruch, der auf eine Spannung in unserem alltäglichen Weltbild hindeutet: Zum einen trennen wir die Bereiche des Physischen und des Mentalen voneinander und behaupten die kausale Abgeschlossenheit des physischen Bereichs. Zum anderen ist uns eine vielfältige Wechselwirkung zwischen diesen Bereichen bewusst, bzw. nehmen wir diese als gegeben hin. Dieser Widerspruch lässt sich als Körper-Geist-Problem in einer Trias in Form dreier Prinzipien formulieren:
1. Der Bereich des Physischen ist kausal lückenlos abgeschlossen.
2. Aus der kausalen Abgeschlossenheit des physischen Bereichs folgt die kausale Wirkungslosigkeit mentaler Entitäten.
3. Mentale Entitäten sind kausal wirksam.
Der Widerspruch, der sich ergibt, wenn alle drei Prinzipien gleichermaßen gültig sein sollen, ist offenkundig. Sie können daher nicht alle zusammen wahr sein. Die philosophischen Ansätze, die das Problem des Verhältnisses von Körper und Geist zu lösen versuchen, beruhen deshalb in der Regel darauf, dass sie eines oder mehrere dieser Prinzipien aufgeben, denn nur so lassen sich die verbleibenden ohne Widerspruch für wahr halten. Entsprechend lassen sich die gängigen Lösungsstrategien zum Körper-Geist-Problem danach, welches der Prinzipien der Trias sie fallenlassen, grob in verschiedene Gruppen einteilen. Hieraus ergibt sich wiederum eine zweite Gliederung, gemäß der sich mit Brüntrup vier philosophische Hauptpositionen zum ontologischen Status des Mentalen in der Welt unterscheiden lassen203:
1. Es gibt mentale Entitäten. Sie sind vom Bereich des Physischen unabhängig. (Dualismus)
2. Es gibt mentale Entitäten. Sie sind nicht vom Bereich des Physischen unabhängig. Sie sind von den ihnen zugrunde liegenden physischen Entitäten abhängig, ohne auf diese reduzierbar zu sein. (Nicht-reduktiver Physikalismus)
3. Es gibt mentale Entitäten. Sie sind nicht vom Bereich des Physischen unabhängig. Sie sind von den ihnen zugrunde liegenden physischen Entitäten abhängig und können vollständig auf diese reduziert werden. (Reduktiver Physikalismus)
4. Es gibt keine mentalen Entitäten. (Eliminativer Materialismus204)
Auch diese zweite Gliederung ist nur sehr grob. Sie ist nicht deckungsgleich mit jener aus der Trias. Doch zusammen ermöglichen beide Einteilungen eine differenziertere Einordnung geistesphilosophischer Theorien. Unter den vier Hauptpositionen zum ontologischen Status des Mentalen sind dabei besonders jene von Interesse, die sich als Spielarten des Physikalismus deuten lassen, der Basisontologie für den größten Teil der geistesphilosophischen Theorien des 20. Jahrhunderts. Seine große Attraktivität und weite Verbreitung genießt der Physikalismus dabei nicht zuletzt aufgrund seines Selbstbilds als adäquate philosophische Umsetzung eines naturwissenschaftlich geprägten und fundierten Weltverständnisses. In seinem Rahmen findet auch die Emergenz in der zeitgenössischen Philosophie wieder ihren Ort.
199 Aufgrund verschiedener Schwierigkeiten, die mit den Begriffen ‚Leib‘ und ‚Seele‘ verbunden sind und auf die besonders Heiner Hastedt hingewiesen hat, wird in der Terminologie – wie es heutzutage zunehmend üblich ist – nicht vom Leib-Seele-Problem, sondern vom Körper-Geist-Problem gesprochen und versucht, die problematischen Begriffe zu vermeiden. Dabei werden die Begriffe ‚Körper‘ oder ‚Physisches‘ auf der einen, die Begriffe ‚Geist‘, ‚Psychisches‘ oder ‚Mentales‘ auf der anderen Seite verwendet. [Vgl. Hastedt, Heiner (1988). Das Leib-Seele-Problem. Zwischen Naturwissenschaft des Geistes und kultureller Eindimensionalität. Frankfurt: Suhrkamp. S. 42-61 und auch Brüntrup (1996). S. 13.]
200 Die Ausführungen in diesem Abschnitt sind im Wesentlichen ein Destillat der besonders geeigneten Problembeschreibung durch Brüntrup [Vgl. Brüntrup (1996). S. 9-22. Besonders S. 9-11 und S. 18-20.].
201 Hier sind neben der Neurobiologie exemplarisch Neurolinguistik, Neuroinformatik, Neurophilosophie, Neurotheologie, Neuropsychologie und Neuropädagogik sowie auch die Künstliche-Intelligenz-Forschung zu nennen.
202 Vgl. Brüntrup (1996). S. 9-22. Besonders S. 9-11 und S. 18-20.
203 Vgl. Brüntrup (1996). S. 21.
204 Bei Brüntrup ist der ‚Eliminative Materialismus‘ als ‚Eliminativer Physikalismus‘ bezeichnet.
7 Exkurs: Modelle der Reduktion
An dieser Stelle ist ein Exkurs zur Frage, auf welchem Modell eine adäquate Reduktion beruhen muss, vorzunehmen205. Dies ist aus zwei Gründen für den weiteren Verlauf unabdingbar: So lässt sich hierdurch nicht nur erhellen, unter welchen Bedingungen geistesphilosophische Theorien als reduktionistisch oder nicht-reduktionistisch gelten können, sondern auch eine unverzichtbare Grundlage für die weiteren Betrachtungen zum Emergenzbegriff legen: Denn Eigenschaften werden in der Regel vor allem deshalb als emergent ausgezeichnet, weil sie nicht reduzierbar sind. Zunächst wird kurz das klassische Modell der Reduktion von Ernest Nagel vorgestellt, das sowohl für Vertreter eines reduktionistischen wie auch eines nicht-reduktionistischen Physikalismus lange Zeit das vorherrschende Modell der Reduktion war.
7.1 Das klassische Modell der Reduktion von Ernest Nagel
Ernest Nagel beschreibt sein Modell der Reduktion in seinem Werk „The Structure of Science“ (1961). Den Begriff der Reduktion definiert er dabei folgendermaßen:
„Reduction, in the sense in which the word is here employed, is the explanation of a theory or a set of experimental laws established in one area of inquiry, by a theory usually though not invariably formulated for some other domain.“206
Nach Nagel ist eine erste Theorie („primary science“207) dann auf eine zweite Theorie („secondary science“208) reduzierbar, wenn sich die Gesetze der zu reduzierenden Theorie entweder direkt oder aber, so dies nicht möglich ist, mittels sogenannter Brückengesetze aus den Gesetzen der Basistheorie ableiten lassen. Brückengesetze übernehmen insofern eine entscheidende Rolle, als sie als nomologische Bikonditionale die – in der Regel voneinander abweichenden – Terminologien der verschiedenen Theorien miteinander verbinden.209 Als Hauptbeispiel für sein Modell führt Nagel die Reduktion der Thermodynamik auf die statistische Mechanik an. Hierbei geht es ihm besonders um die Ableitung des von Boyle-Charles formulierten Gesetzes für ideale Gase (‚p * V = N * k * T‘210), welches er mit Hilfe von zwei Brückengesetzen (‚p = M‘ und ‚2/3 * E = k * T‘) aus einem aus den Gesetzen der statistischen Mechanik – genauer: der kinetischen Theorie der Gase – abgeleiteten Gesetz (‚M * V = 2/3 * N * E‘) deduziert. Da weder der Begriff ‚p‘ (Druck) noch der Begriff ‚T‘ (Temperatur) zur Terminologie der statistischen Mechanik gehören, bedarf es der beiden Brückengesetze, um die Verbindung zwischen den Begriffen ‚p‘ (Druck) und ‚V ‘ (Volumen) aus der Thermodynamik und den Begriffen ‚M‘ (Durchschnitt der von den Molekülen des Gases auf die Wände des Containers übertragenen Momente) und ‚E‘ (durchschnittliche kinetische Energie dieser Moleküle) aus der statistischen Mechanik herzustellen und somit die Ableitung möglich zu machen.211
7.2 Probleme des Nagelschen Reduktionsbegriffs
So weit verbreitet