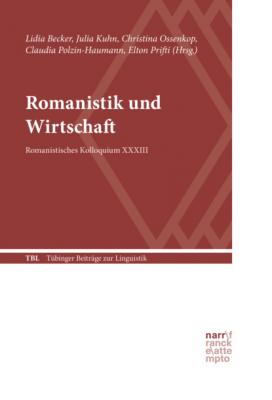ТОП просматриваемых книг сайта:
Romanistik und Wirtschaft. Группа авторов
Читать онлайн.Название Romanistik und Wirtschaft
Год выпуска 0
isbn 9783823302773
Автор произведения Группа авторов
Жанр Документальная литература
Серия Tübinger Beiträge zur Linguistik (TBL)
Издательство Bookwire
5.1 Der statische Aspekt
Im Zusammenhang mit dem statischen Aspekt kann man die Ausdrücke anführen, die das Ranking selbst bezeichnen (classement, liste, ranking, vgl. Bsp. 12, palmarès, aber auch le top 100, le top 10, etc.); begleitet werden sie oft von Adjektiven, die die Grundgesamtheit angeben (classement mondial, classement des meilleurs) oder von Ausdrücken, die das Kriterium benennen (en termes de valeur, en termes de volume).
Wichtig sind auch die Wörter, die Plätze im Ranking bezeichnen (place, position, rang); sie werden von Ordinalzahlen begleitet (à la 17e place, en 26e position). Aber diese Zahlen werden auch oft substantiviert und bezeichnen dann den Inhaber1 des jeweiligen Ranges (le premier, le deuxième); im Französischen gibt es außerdem eine Konstruktion mit dem Numerale (als Bezeichnung des Rang-Inhabers) als « attribut du sujet » (être deuxième, arriver troisième, se classer quatrième, finir cinquième).
| 12) | HEC, une première place incontestée Dans le célèbre ranking du quotidien britannique Financial Times, le MBA d’HEC arrive 18e, celui de l’Insead, 7e. En ce qui concerne le classement 2007 du FT des meilleurs business schools européennes, HEC arrive sur la première marche du podium avant London Business School.2 |
Zu erwähnen sind auch die Ausdrücke für die ersten drei Plätze und deren InhaberInnen: Dafür steht metonymisch das Siegerpodest (podium, vgl. Bsp. 12, gelegentlich auch piédestal), das typischerweise mit dem Verb se hisser auftritt: eine Vertikalitäts-Metapher (Bsp. 13).
| 13) | Cavalier de haute précision (Steve Guerdat) A l’automne, un titre acquis au Grand Prix de Rio de Janeiro permet au trentenaire de se hisser, durant un mois, à la première place du classement Rolex Ranking de la FEI. Rejoignant sur ce piédestal ses prédécesseurs et compatriotes Markus Fuchs et Pius Schwizer, Steve Guerdat confirmait ainsi la force de frappe de l’équitation helvétique sur l’échiquier mondial.3 |
Das Französische verfügt über einen besonderen Reichtum an Verben, die diese Platz-Zuweisungen einleiten,4 und zwar sowohl aktiv (arriver quatrième, se classer deuxième, occuper le troisième rang, obtenir la deuxième place, finir dernier) als auch passiv (la troisième place est occupée par / est attribuée à…, être classé deuxième). Die originellsten davon betonen die aktive Rolle des Teilnehmers (se hisser au troisième rang, se positionner quatrième, prendre/décrocher les trois premières places, émerger/pointer au quinzième rang). Das folgende Beispiel illustriert die Verwendung von mehreren der hier beschriebenen Verben:
| 14) | Google, Apple, Samsung ou Sony, quelles sont les marques les plus réputées ? La marque bavaroise BMW arrive en tête du classement pour la deuxième année consécutive avec un résultat de 78.39/100. Son compatriote germanique Daimler (Mercedes-Benz) pointe à la 5e place (76.58/100) et Volkswagen à la 13e place (74.38/100). La première entreprise américaine est The Walt Disney Company, seconde du classement avec une note de 77.76/100 tandis que la manufacture horlogère helvétique Rolex ferme le podium en prenant la troisième place avec 77.23 points.5 |
In derselben Gruppe, die nämlich den Teilnehmer als aktiv darstellt, findet man s’adjuger un titre, als ob der Sportler seine eigene Jury wäre; die Darstellungsweise ähnelt der bei ravir (z. B. ravir la première place, vgl. Bsp. 16), aber s’adjuger ist sozusagen „legitimistischer“.
Wir kommen nun zu den Ausdrücken, die den ersten Platz im Klassement bzw. metonymisch den Erstplatzierten bezeichnen: Hier finden sich wenig überraschend le premier rang, la première place, la première marche du podium (vgl. Bsp. 12). Aber der Ausdruck, der selbst an der Spitze steht, wenn es darum geht, über den ersten Platz zu sprechen, ist das französische Äquivalent von ‚an der Spitze‘, nämlich en tête. Es wird mit einer ganzen Reihe verschiedener Verben kombiniert und bestätigt so die Beobachtung, dass das Französische bei Rankings vor allem die verbale Kategorie besonders gut ausgebaut hat. Man findet also être en tête, arriver en tête, courir en tête, se positionner en tête, aber auch (ohne Präposition) garder la tête, prendre la tête. In den meisten dieser Ausdrücke kann tête eine Erweiterung beinhalten, die das ‚Klassement als Ganzes‘ oder die ‚Gruppe der Mitbewerber‘ bezeichnet, z. B. en tête du classement, en tête de peloton (Radfahr-Metapher) und andere. Die Metapher erscheint auf den ersten Blick simpel: ein Anthropomorphismus, wie er im Buche steht, kombiniert mit dem Schema von Lakoff/Johnson 1980 OBEN = POSITIV, UNTEN = NEGATIV. Aber die Dinge liegen dann doch nicht so einfach. Denn das Gegenteil von en tête de peloton, ist nicht etwa *aux pieds du peloton, sondern: en queue de peloton! Wir müssen also zunächst einmal unsere ganze Geometrie umdrehen, denn hier haben wir ein horizontales und nicht ein vertikales Schema: VORNE = POSITIV, HINTEN = NEGATIV. Und außerdem müssen wir auf biologischer Ebene umschalten, denn der Kopf von en tête de gehört nun plötzlich nicht mehr einem Menschen, sondern einem Tier – einem Tier, das läuft.
Es ist nun an der Zeit, in einem Exkurs über die beiden geometrischen Achsen nachzudenken, die vertikale und die horizontale. Beide spielen eine wichtige Rolle bei der Konzeptualisierung von Rankings. Das Prinzip OBEN = POSITIV, UNTEN = NEGATIV, also die vertikale Achse, hängt vor allem in der Wirtschaft (s.o., Kap. 4) mit den Graphiken zusammen, die die Entwicklung eines Indikators über die Zeit darstellen. Auch im Sport und bei den Sportmetaphern ist diese Achse wichtig, weil sie dem Siegerpodest und der Reihenfolge der drei Besten entspricht. Aber die wichtigere der beiden Achsen ist bei Rankings, im Sport wie überall anders, eigentlich die horizontale, also die Konzeptualisierung VORNE = POSITIV, HINTEN = NEGATIV. Es geht um das Bild des Siegers, der vorne, an der Spitze (en tête) liegt, während der Letzte den Schwanz darstellt (la queue), und die Menge der Mitbewerber das Feld (le peloton). Die Grundmetapher ist die des Wettrennens, das für tête und queue noch einmal metaphorisiert wird, nämlich, wie schon erwähnt, als ein Tier, das läuft. Beim peloton hat ursprünglich das Stricken die Armee inspiriert, die ihrerseits das Radrennen inspiriert hat, und dieses inspiriert nun seinerseits alle anderen Bereiche. Im Sport wird übrigens die Metapher des Wettrennens auch in all jenen Sportarten angewandt, die eigentlich kein Wettrennen enthalten (von Ski über Tennis bis Fußball), denn man hat ja immer eine (Leistungs-)Rangordnung, die in Bewegung, in Veränderung, begriffen ist; in der Wirtschaft und in vielen anderen Lebensbereichen wird die Wettrennen-Metapher ebenfalls auf sämtliche Indikatoren angewandt, solange sie nur ein Ranking ergeben können.