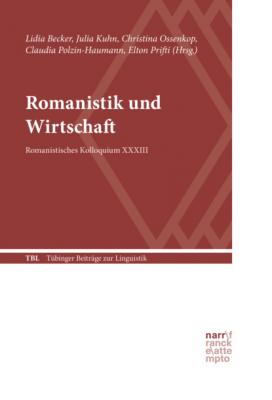ТОП просматриваемых книг сайта:
Romanistik und Wirtschaft. Группа авторов
Читать онлайн.Название Romanistik und Wirtschaft
Год выпуска 0
isbn 9783823302773
Автор произведения Группа авторов
Жанр Документальная литература
Серия Tübinger Beiträge zur Linguistik (TBL)
Издательство Bookwire
In dieser kurzen Textpassage stoßen wir auf:
Nominalisierungen (explosion, montée, difficulté), Relationsverben (provoquer, contribuer à) und weitere typische Kennzeichen des Nominalstils;
Zahlen (400 000), Prozentsätze (25 %, 85 %, 45 % etc.), Steigen-und-fallen-Verben (bondir, augmenter) mit der ganzen für sie charakteristischen Syntax (ont bondi de 76 % de 2009 à 2016), quantitative Adjektive (fort, cher, élevé), Modulatoren (près de) usw. usf., also jede Menge quantitative Ausdrücke;
und schließlich eine Vielfalt an Ausdrücken aus dem Bereich der Rankings: Superlative und Ausdrücke der Unizität (la plus grande, la seule, la plus chère), Ordinalzahlen (première, deuxième), Adjektive, die die Grundgesamtheit eines Vergleichs anzeigen (européen/ne, mondial/e); weiters Ausdrücke, die das Ranking selbst (palmarès), oder einen Rang darin bezeichen (place), mit den dazugehörigen Verben (occuper); nicht zu vergessen die Präposition pour, die das Kriterium des Rankings (pour le marché des changes, pour les crédits bancaires internationaux) und die Präposition derrière, die das vorangehende Element im Ranking einleitet (derrière New-York, derrière Londres).
2 Einleitung
In diesem Beitrag soll es um all das gehen, was – wie die soeben aufgezählten Elemente – abgesehen von der Terminologie für Fachdiskurse bestimmter Fächer oder verwandter Fächerbündel charakteristisch ist. Denn die Terminologie allein reicht nicht aus, um einen Text zu konstituieren; sie braucht die Ergänzung durch nicht-terminologische Mittel auf lexikalischer und syntaktischer Ebene, die die terminologischen Elemente als Umfeld, als Umwelt, als Biotop einbetten.
In diesem Zusammenhang steht zunächst das Konzept des „Fachstils“, also jener „allgemeinen wissenschaftlichen Fachsprache“, die für das Französische in etlichen Publikationen von Werner Forner beschrieben worden ist und der in jüngerer Zeit eine Sondernummer der « Revue française de linguistique appliquée » (Tutin 2007a) gewidmet war. Es geht um sprachlich-stilistische Procédés bzw. eine gewisse „allgemeine wissenschaftssprachliche Lexik“, die Fachzeitschriften bzw. -publikationen und divulgativen Fachtexten so gut wie sämtlicher Disziplinen bzw. breiter Disziplinenbündel (technische Wissenschaften, Sozialwissenschaften) gemeinsam sind; aber das ist es nicht, was uns hier primär interessieren wird.
Was ich beschreiben möchte, das ist eine bestimmte Schicht lexikalisch-syntaktischer Mittel, die nicht allen Disziplinen gemeinsam sind, sondern ganz bestimmten Bündeln verwandter Disziplinen: zum Beispiel der Sprache der Wirtschaft oder jener des Sports. Jedes Fach und jedes Fächerbündel verfügt jenseits der Terminologie über charakteristische sprachliche Mittel, die zwar aus der Allgemeinsprache übernommen, aber durch ihre Frequenz und spezielle Funktion doch für das jeweilige Fach/die jeweiligen Fächer charakteristisch sind; weswegen man auch Fachsprachen und Fachdiskurse nur dann zutreffend beschreiben oder lehren kann, wenn man diese Ausdrucksmittel mit einbezieht. Dazu gehören für Wirtschaftstexte die Ausdrücke für das Steigen und Fallen von Zahlen und Werten, und für die Wirtschaftssprache und die Sportsprache gemeinsam, die Ausdrücke für Rankings und deren Veränderung.
Anhand dieser Beispiele möchte ich jenes Phänomen beschreiben und illustrieren, das ich als die „Mittlere Schicht“ der fachsprachlichen Diskurse bezeichne. Es zeigt sich, dass diese „Mittlere Schicht“ in jedem Fach eng mit jenen grundlegenden Konzeptualisierungen der jeweiligen Disziplin verbunden ist, welche in Form von fachspezifischen Grundmetaphern das Weltbild des Faches prägen.
Abschließend werde ich versuchen, in Form einer konzeptuellen Metapher das Feld der Fachdiskurse mit seinen mehr oder weniger zentralen versus peripheren Elementen zu beschreiben und in diesem Rahmen die „Mittlere Schicht“ zu situieren.
3 „Allgemeine Wissenschaftssprache“ und „Fachstil“ nach Forner und Tutin 2007a
Ich beginne hier mit der Beschreibung dessen, was eigentlich nicht im Zentrum meines Interesses steht, was also nicht die „Mittlere Schicht“ ist, aber von ihr abgegrenzt werden muss. Es handelt sich um ein bestimmtes Register bzw. Repertoire sprachlicher Mittel, das in der Forschung als « langue scientifique générale » (Phal 1968, 8) oder als „allgemeine wissenschaftliche Fachsprache“ (Hoffmann 21984, 63) bezeichnet worden ist. Es entspricht der Gesamtheit jener sprachlichen Mittel, die den Fachdiskursen der verschiedensten Fächer gemeinsam sind. Diese Kategorie „allgemeine Wissenschaftssprache“ und noch mehr „allgemeine wissenschaftliche Fachsprache“ ist in gewisser Weise paradox, denn das Besondere an Fachsprache und damit auch an Wissenschaftssprache ist ja, dass sie für ein bestimmtes Fach – und eben nicht für sämtliche Fächer gemeinsam – charakteristisch ist. Es existieren aber sehr wohl einige interessante Versuche, eine solche „allgemeine Wissenschaftssprache“ zu definieren und zu beschreiben.
Gemeint ist im Wesentlichen eine Art genrespezifisches Register1: die Sprache wissenschaftlicher Publikationen bzw. auch anspruchsvoller populärwissenschaftlicher Artikel. Man kann sich diesem Register aus verschiedenen Perspektiven annähern, einerseits über die Stilistik und Syntax und andererseits über die Lexik. Ersterer „Approach“ ist der von Werner Forner, letzterer wird von den Pionieren Phal (1968 und 1971) und Coxhead (1998 und 2000) vorgegeben und in der Sondernummer Tutin 2007a der «Revue française de linguistique appliquée » vertieft.
Definiert man die „allgemeine Wissenschaftssprache“ als eine Art „Fachstil“ mit spezifischen Ausdrucksmitteln, die – allerdings in geringerer Frequenz – auch in der Allgemeinsprache anzutreffen sind, so kann man versuchen, diese « langue scientifique générale » über ihre spezifischen stilistischen Merkmale zu beschreiben. Der Forscher, der sich diesem Programm für das Französische Jahrzehnte hindurch gewidmet hat, ist Werner Forner2. Er spricht von « style scientifique » bzw. von „registerspezifischen Vertextungsstrategien“ (stratégies de textualisation propres au registre scientifique). Um einen ersten Eindruck davon zu geben, was unter diese Bezeichnung fällt, kann man gewisse Konjunktionen anführen, weiters Aufzählungen, metatextuelle Verweise und andere Eigenheiten der Wissenschaftssprache:
| 2) | d’une part – de l’autre/d’autre part ; d’un côté – de l’autre ; d’un autre côté premièrement… deuxièmement… troisièmement ; d’abord… ensuite… enfin ci-dessus, ci-dessous, ci-contre nous venons de voir que… |
Elemente wie diese interessieren Werner Forner allerdings nur am Rande. Was er wirklich beschreibt, das ist eine Reihe von sprachlichen Procédés, die dazu beitragen, einem Text ein « air de spécialité