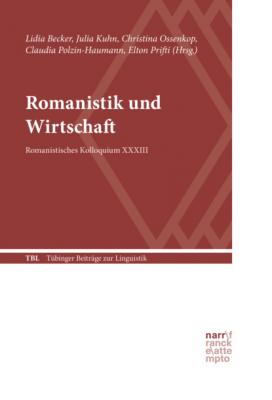ТОП просматриваемых книг сайта:
Romanistik und Wirtschaft. Группа авторов
Читать онлайн.Название Romanistik und Wirtschaft
Год выпуска 0
isbn 9783823302773
Автор произведения Группа авторов
Жанр Документальная литература
Серия Tübinger Beiträge zur Linguistik (TBL)
Издательство Bookwire
1 Le lexique propre aux écrits scientifiques […]
2 Le lexique abstrait non spécialisé […]
3 Le lexique méthodologique disciplinaire […]
4 Le lexique terminologique […]
5 Le lexique de la langue « générale » ou « commune » […]
Sieht man sich jedoch die einzelnen Studien in dieser Sondernummer genauer an, so muss man erkennen, dass es den AutorInnen gerade nicht darum geht, disziplinspezifische nicht-terminologische Lexik zu erheben (das wäre in etwa Tutins Schicht 3, wobei ich ja nicht nur an methodologischer Lexik interessiert bin). Sie sammeln vielmehr (wie schon Phal und Coxhead) gezielt jene Lexik und jene Phraseologismen/Kollokationen, die in einer möglichst breiten Auswahl möglichst disparater Disziplinen gleichermaßen zur Anwendung kommen (also Tutins Schicht 1).
So arbeitet Drouin 2007 an einem Korpus französischer Dissertationen aus den Bereichen Psychologie, Recht, Geschichte, Geographie, Archäologie, Physik, Technik, Informatik und Chemie, das er gegen ein Vergleichskorpus der Zeitung « Le Monde » abhebt. Kriterium für seine Wortlisten ist, dass ein Ausdruck oder eine Kollokation in mindestens der Hälfte der von ihm untersuchten Fächerkorpora signifikant oft vorkommt.
Pecman 2007, der die Phraseolexik – also die Ausdrücke plus ihre syntaktische Konstruktion und Umgebung – untersucht, arbeitet an einem Korpus wissenschaftlicher Texte aus den « sciences dures », konkret aus den Disziplinen Biochemie, molekulare Chemie, Botanik, Biowissenschaften, Erdwissenschaften, Physik, Mechanik, Astronomie und Astrophysik. Auch ihm geht es darum, lexikalische Einheiten zu identifizieren, die sämtlichen Disziplinen gemeinsam sind. Er kommt zu dem Schluss, dass es eine „allgemeine Wissenschaftssprache“ auf der Ebene der Phraseolexik (im Gegensatz zur terminologischen Ebene) tatsächlich gibt. Auch hier bleiben wir allerdings in Tutins erster Schicht, auch wenn nicht der Anspruch erhoben wird, Aussagen über die lexikalischen Überschneidungen sämtlicher existierender Disziplinen zu treffen.
Sehr breiten Disziplinenbündeln widmet sich auch Blumenthal 2007, der zwei (populär-)wissenschaftliche Korpora vergleicht, eines aus den « Sciences de l’Homme » und eines aus den « Sciences exactes » (beide aus Enzyklopädien). Ihm geht es darum, durch das Studium der transdisziplinären Lexik der beiden Bereiche nachzuweisen, dass es sich tatsächlich um zwei ganz unterschiedliche Wissenschaftskulturen handelt. Auch hier sind die Fächerbündel zu breit, um meinem eigenen Interesse zu entsprechen, das ja jenen sprachlichen Mitteln gilt, die, ohne terminologisch zu sein, für eine Disziplin oder auch für ein kleines Bündel verwandter Disziplinen charakteristisch sind. Eben jene „Mittlere Schicht“, bei der noch immer eine regelrechte Forschungslücke klafft, die ich hier ein wenig zu schließen versuchen werde.
4 Augmenter, diminuer…: Quantitive Ausdrücke in Wirtschaftsdiskursen1
Ich komme mit diesem Kapitel zum Kern meines Beitrags, denn die quantitativen Ausdrücke entsprechen im Rahmen der Wirtschaftssprache genau dem, was ich als „Mittlere Schicht“ beschreiben möchte. Im Gegensatz zur Terminologie und in ähnlicher Weise wie die Rankings, denen das folgende Kapitel 5 gewidmet sein wird, sind die quantitativen Ausdrücke nicht nur für ein Fach charakteristisch, sondern für ganze Bündel verwandter Disziplinen. Zum Beispiel kann man die sprachlichen Mittel untersuchen, mit denen Statistiken wiedergegeben werden, und das betrifft dann eine ganze Reihe von Fächern, in den Natur- wie auch in den Sozialwissenschaften, zwischen denen es allerdings signifikante Unterschiede geben dürfte. Und – um ein weiteres Beispiel zu geben – die Ausdrücke für Ursachen und Wirkungen sind wahrscheinlich nicht identisch in Diskursen der technischen und der naturwissenschaftlichen Disziplinen, wobei es auch Überschneidungen geben könnte.
Beginnen wir also mit den quantitativen Ausdrücken, und hier mit dem Teilbereich der sprachlichen Mittel für das Steigen und Fallen von Zahlen und Werten; es handelt sich um einen Bedeutungsbereich, der im Sinne der kognitiven Linguistik auch als „Frame“2 beschrieben werden kann. Schon in unserem Text (1) gab es mehrere Beispiele dafür:
| 10) | …cela provoquerait une explosion du coût de l'immobilier, déjà astronomique dans la capitale française. Paris est la deuxième ville la plus chère d'Europe, derrière Londres où les prix ont bondi de 76 % de 2009 à 2016 (alors que les salaires britanniques n'ont pas augmenté ). Socialement, un coût de l'immobilier élevé contribue à la montée des injustices et des inégalités |
Diese kurze Passage ist deswegen interessant, weil das Steigen und Fallen in mehreren syntaktischen und semantischen Varianten vorkommt: von der Standard-Variante in verbaler (augmenter) und nominaler (montée) Form, bis zu metaphorischen Ausdrücken für denselben Sachverhalt, ebenfalls verbal (bondir) und nominal (explosion). Auffällig ist auch die Präpositionalsyntax, die diese Einheiten umgibt: V augmente (V ist der Wert – la valeur – deren Veränderungen man verfolgt), V bondit de n (n symbolisiert eine Zahl, hier einen Prozentsatz), une explosion de V, la montée de V. Ich beginne mit einer kurzen semantischen Einteilung dieser Ausdrücke, um dann deren Metaphorik und schließlich die sie umgebende Syntax zu analysieren.
Die sprachlichen Mittel des Bedeutungsfelds/Frames Steigen/Fallen können nach folgenden Kriterien eingeteilt werden:3
Steigen vs. Fallen vs. Veränderung ohne Richtungsangabe vs. Gleichbleiben (augmenter, diminuer, osciller, se maintenir)
Verbale vs. nominale Ausdrücke (s’accroître – accroissement; se réduire – réduction; osciller – oscillation; stagner – stagnation)
Autonome vs. passive Veränderung = Intransitivität vs. Transitivität (s’améliorer – améliorer, se réduire – réduire)
Positive / negative / neutrale Evaluation der Veränderung (envolée – explosion – bond)
Was die Metaphorik anbelangt, so stellt man fest, dass sogar die Standardvariante metaphorisch ist, denn hier werden numerische Werte in den Raum projiziert. Das entspricht einer konzeptuellen Metapher, wie sie Lakoff/Johnson (1980) beschreiben: WENIG = UNTEN, VIEL = OBEN, bzw. in einer komparativen Variante: WENIGER = UNTEN, MEHR = OBEN. Auch die „sekundären“, viel deutlicher metaphorischen, Varianten bondir und exploser entsprechen im Übrigen derselben konzeptuellen Metapher, zu der allerdings weitere Metaphorisierungen hinzukommen. Den grundlegenden metaphorischen Prozess dabei beschreibt Schifko (1992, 560-562):
Der entscheidende Schritt von der direkten zu einer metaphorischen Ausdrucksweise geschieht durch die Projizierung der quantitativen Äußerung in den Raum. […] Die erste Stufe, bei der nicht immer klar entscheidbar ist, ob es sich um eine metaphorische handelt, ist die Transposition des Mehr- bzw. Wenigerwerdens in ein Größer- bzw. Kleinerwerden, d.h. die Sicht der Anzahl als räumliche Dimension. […]
Bei Aufwärtsbewegungen geht es mit den Meßzahlen ‚nach oben‘ […], bei Abwärtsbewegungen ‚nach unten‘ […], wohl einem menschlichen Urempfinden entsprechend, welches auch bei den die Daten begleitenden Graphiken zum Ausdruck kommt […]. Die Bewegung kann abstrakt oder konkretisiert als Fliegen, Tauchen, Klettern, Graben, etc., in Erscheinung treten.
Wenn man es genauer betrachtet (Abb. 1), erkennt man allerdings, dass die Basismetapher über die simple Vertikalität hinausgeht und einem wesentlich komplexeren Schema entspricht. Der Schlüssel liegt in jenen Graphiken, die bereits von Schifko (s.o.) erwähnt werden: Das Steigen und Fallen von Werten wird im Allgemeinen in Form von Kurvengraphiken visualisiert, mit der Zeit auf der X-Achse und den Werten auf der Y-Achse. Auf genau diese Art von Graphiken beziehen