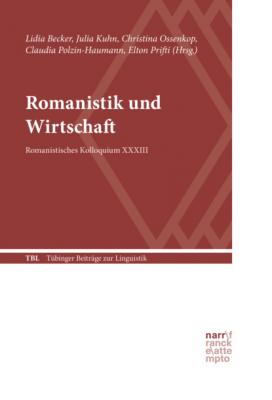ТОП просматриваемых книг сайта:
Romanistik und Wirtschaft. Группа авторов
Читать онлайн.Название Romanistik und Wirtschaft
Год выпуска 0
isbn 9783823302773
Автор произведения Группа авторов
Жанр Документальная литература
Серия Tübinger Beiträge zur Linguistik (TBL)
Издательство Bookwire
de ist die Standard-Präposition für die Differenz C: s’accoître de 3 %, se réduire de 3 millions de dollars;
Will man den Ausgangs- und den Endwert, also A und B, ausdrücken, kann man daher eben gerade nicht auf de und à zurückgreifen, weil de ja schon vergeben ist; daraus ergeben sich übrigens sogar Schwierigkeiten, wenn man den Endwert mit à einleiten will.6 Die einzige praktikable Lösung bietet die Verwendung eines Spezialverbs; passer ist in der Tat das einzige Verb, das man mit den Präpositionen de und à verbinden kann, um Ausgangs- und Endwert anzugeben: passer de A à B. Auffällig ist, dass das Verb die Richtung der Veränderung offen lässt – diese geht ja ohnehin aus den Werten A und B hervor. Wenn man es genau nimmt, ist passer mit dieser seiner Besonderheit doch nicht ganz allein, denn auch revenir de A à B und être ramené de A à B (beide im Sinne einer Verringerung) funktionieren mit dem Präpositionen-Paar de und à.
Die Ausdrücke des Typs augmenter de 6 points pour s’inscrire à 20 % / pour se fixer à 20 % / passant ainsi à 20 % entsprechen einem gängigen Verwendungstyp von de…à, bei dem à den Endpunkt B einleitet, de allerdings auf die Differenz C beschränkt bleibt; der Ausgangspunkt A wird dabei nicht genannt, er kann allerdings aus den beiden anderen Werten erschlossen werden.
Wir gehen nun zur Analyse eines semantischen Feldes über, das mit den quantitativen Ausdrücken verwandt ist und bei dem sich die Sport- und die Wirtschaftssprache treffen.
5 Rankings in Sport- und in Wirtschaftsdiskursen1
Zu Beginn dieser Präsentation der Ranking-Diskurse möchte ich auf eine entsprechende Passage aus unserem Beispiel (1) zurückgreifen:
| 11) | Londres est la plus grande place financière mondiale . […] Elle est la première place mondiale pour le marché des changes […]. Elle est première aussi pour les crédits bancaires internationaux, les produits dérivés, les marchés des métaux et de l'assurance. Elle occupe la deuxième place du palmarès mondial (derrière New-York) pour les emprunts internationaux […]. Elle […] est la seule place financière européenne vraiment globale. […] Paris est la deuxième ville la plus chère d'Europe, derrière Londres […]. |
Rankings sind ein konzeptuelles Feld,2 das für eine ganze Reihe von Fachdiskursen konstitutiv ist: vom Sport über die Wirtschaft, die Musik, das Verlagswesen und die Politik, bis hin zu den Universitäten und wissenschaftlichen Zeitschriften, die es sich alle gefallen lassen müssen, nach Leistung oder „Qualität“ gerankt zu werden. Ausgangspunkt soll hier ein konzeptuelles Modell des Rankings sein, also eine Art Frame oder Szenario, mit prototypischen Beteiligtenrollen, den Beziehungen zwischen diesen Rollen und den Handlungen und Prozessen, die charakteristischerweise zwischen ihnen ablaufen.
Den Elementen einer Grundgesamtheit (Ländern, Regionen, Firmen, Produkten, Personen, insbesondere Sportlern oder Teams) werden über ein Kriterium (Punktewertung, Rennzeit, Wirtschaftsleistung, Marktanteil, Arbeitslosenrate, Einschaltquote etc.) numerische Werte zugeordnet. (Manchmal geschieht die Zuordnung bzw. Be-Wertung durch eine Instanz wie eine Rating-Agentur oder einen Schiedsrichter.) Aufgrund dieser Werte werden dann die Elemente gereiht, d.h. es erfolgt eine Zuordnung zu den Zahlen von 1 bis n (n = Anzahl der Elemente der Grundgesamtheit).3 Die so entstandene Rangordnung hat ein gutes und ein schlechtes Ende. Meist ist Rang 1 das gute und Rang n das schlechte Ende, aber wenn es sich bei dem, was bewertet wird, um Negatives wie z. B. Korruption, Krankheiten etc. handelt, ist es umgekehrt. Ist das Kriterium eine Art von Leistung, dann wird im Sport (und in der Wirtschaft metaphorisch) an die ersten drei ein Preis vergeben, und sie steigen auf das Siegerpodest, um eine Trophäe zu erhalten.
Im Französischen und in anderen Sprachen gibt es spezielle Ausdrücke für das Ranking selbst, für jeden einzelnen der Rangordnungs-Plätze und für diejenigen, die diesen Rang einnehmen. Es gibt auch eine eigene Kriteriums-Syntax (premier en termes de PIB) und Adjektive, die die Grundgesamtheit angeben (troisième producteur mondial de […]).
Jedes Element der Grundgesamtheit hat einen bestimmten Rang; sie können über diesen Rang verglichen werden, aber auch über die Werte, die sie beim Kriterium erreichen, z. B. kann der Abstand zwischen Erstem und Zweitem gemessen werden. Innerhalb des Rankings können außerdem Untergruppen gebildet werden, z. B. die Spitzengruppe, das Mittelfeld, die Schlusslichter – und für all das gibt es eine jeweils eigene Syntax wie auch eigene idiomatische Ausdrücke und Kollokationen.
Das ist der statische Aspekt des Rankings. Zusätzlich gibt es aber noch einen sehr wichtigen dynamischen Aspekt: Man erkennt ihn z. B. im Gegensatz zwischen dem Sieger (vainqueur), der ein für alle Mal feststeht (das ist der „perfektive“ Aspekt), und dem Führenden (leader), der lediglich zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt das Klassement anführt („imperfektiver“ Aspekt). Das Ranking entwickelt sich also in der Zeit, weil sich über einen gewissen Zeitraum hinweg die Kriteriums-Werte jedes Elements der Grundgesamtheit ändern und damit auch die Rangordnungs-Plätze verschieben. Damit wird das Ranking zum (dynamischen) Wettrennen/Wettlauf, dessen Elemente meist als konkurrierende Akteure konzeptualisiert werden, wie das im Wettkampf-Sport tatsächlich zutrifft. Jedes einzelne Ranking wird damit zur Momentaufnahme in einem dynamischen Konkurrenz-Feld, was jedenfalls die Darstellung deutlich dramatisiert und in journalistischen Texten weidlich ausgeschlachtet wird. In diesem Bereich der Veränderungen über die Zeit ist es schwer, neutrale, nicht-metaphorische Bezeichnungen zur Beschreibung des Ranking-Schemas zu finden. Gewisse Teile des Schemas sind nämlich besonders „metaphern-anfällig“, insbesondere der erste und in geringerem Maße der letzte Platz, sowie eben die Konkurrenz um die Erstreihung. Der Kampf zwischen Führendem und Verfolger oder Verfolgern ist es, der bei Rankings vor allem die Aufmerksamkeit auf sich zieht, wie ja auch schon unser Beispiel (1)=(11) zeigt. In den Beschreibungen dieses „Wettlaufs“ häufen sich die Metaphern; die sprachlichen Mittel dafür sind extrem vielfältig und oft sehr originell, wie wir in der Folge sehen werden. Dabei werden wir uns hier vor allem mit den verschiedenen Elementen des Ranking-Frames beschäftigen und gleichsam en passant die interessanten metaphorischen Konzeptualisierungen mitnehmen.
Die Vorgangsweise ist dabei zunächst dezidiert onomasiologisch; sie gewinnt eine semasiologische Seite dazu, weil Texte aus dem Internet untersucht und darin systematisch die Ranking-Ausdrücke erhoben werden.4 Die daraus hervorgegangene Sammlung illustriert den Reichtum dieses Feldes und seine interessanten metaphorischen Konzeptualisierungen.
Bezüglich der Metaphern ist der Sport die Schlüsseldomäne der Rankings, bei der sich alle anderen Fächer, und insbesondere die Wirtschaft, ihre Konzeptualisierungen gleichsam „ausborgen“.5 Aber nicht alle Sportarten sind als Bildspender gleich wichtig: Die wichtigste metaphorische Konzeptualisierung ist das Wettrennen, dessen Konzepte auf andere Sportarten sowie auf wirtschaftliche Zusammenhänge übertragen werden.
Ich präsentiere hier nur einen kurzen Überblick über die wichtigsten sprachlichen Mittel, mit denen Rankings im Französischen ausgedrückt werden sowie über die gängisten Metaphorisierungen in diesem Bereich; in den Beispielen6 wird sich zeigen, dass die Ranking-Ausdrücke in den Sport- und in den Wirtschaftsdiskursen –