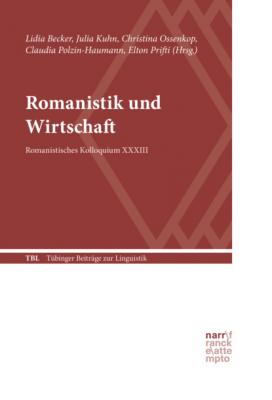ТОП просматриваемых книг сайта:
Romanistik und Wirtschaft. Группа авторов
Читать онлайн.Название Romanistik und Wirtschaft
Год выпуска 0
isbn 9783823302773
Автор произведения Группа авторов
Жанр Документальная литература
Серия Tübinger Beiträge zur Linguistik (TBL)
Издательство Bookwire
6 Schluss
Im Zentrum dieses Beitrags standen jene sprachlichen Mittel, die man als die „Mittlere Schicht“ der Fachsprachen bezeichnen kann. Ich hoffe, gezeigt zu haben, dass es hier einen breiten Bereich der Fachdiskurse gibt, der einer genaueren Beschreibung noch weitgehend harrt. Diese Schicht liegt, was den Fachlichkeitsgrad angeht, in der Mitte zwischen der hochspezifischen Fachterminologie der einzelnen Disziplinen einerseits und den generellen gemeinsprachlichen Mitteln andererseits, aus denen sich fachsprachliche Diskurse speisen; er ist dabei aber eindeutig fachspezifischer als die „allgemeine Wissenschaftssprache“.
Es handelt sich um nicht-terminologische sprachliche Elemente, die durch ihre Frequenz und Funktion bestimmte Fachsprachen und -diskurse kennzeichnen. Gewisse, aber nicht sämtliche, Fachdiskurse, denn das unterscheidet die „Mittlere Schicht“ von der sogenannten „allgemeinen Wissenschaftssprache“ oder dem „Fachstil“, wie er von Werner Forner und von den BeiträgerInnen zur Sammlung von Tutin 2007a beschrieben wurde. Er kennzeichnet aber gewisse Fachsprachen und -diskurse im Plural, denn meist verbinden sich mehrere verwandte Fächer in ihrer Präferenz für gewisse semantische und/oder syntaktische Elemente. Beispiele wären die Ausdrücke für das Steigen und Fallen von Werten, die in Kapitel 4 beschrieben wurden, und die nicht nur für Wirtschafts-, sondern auch für Soziologie- und Demographie-Diskurse charakteristisch sind. Wir haben außerdem gesehen, dass die Basismetapher dieses Bereichs, die Kurvengraphik, einer grundlegenden konzeptuellen Metapher der Wirtschaftswissenschaften entspricht. Die in Kapitel 5 analysierten Ranking-Ausdrücke verbinden ihrerseits die Wirtschaftssprache mit der Sprache des Sports, wobei eine ganze Reihe von Sport-Metaphern, insbesondere das Wettrennen, in eine Reihe anderer Domänen übernommen werden. In ähnlicher Weise könnte man die Ausdrücke für Ursache und Wirkung in verschiedenen Disziplinen vergleichend untersuchen: Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik. All diese sprachlichen Mittel sind generell nicht einer Einzeldisziplin zugehörig (wie es ja die Terminologie ist), und auch nicht andererseits der Gesamtheit wissenschaftlicher Disziplinen (wie die „allgemeine Wissenschaftssprache“), sondern sie bedienen Bündel verwandter Fächer, für die sie durch ihre Frequenz und Funktion charakteristisch sind. Diese typischen, präferierten sprachlichen Ausdrücke bilden die hier illustrierte und beschriebene „Mittlere Schicht“, ohne die man weder Fachdiskurse beschreiben noch Fachsprachen unterrichten kann.
Die Tatsache, dass es diese „Mittlere Schicht“ gibt, sollte uns auch zu denken geben, was die Struktur der Sprache und ihrer Varianten betrifft, und sollte uns abbringen von der Vorstellung der Fachsprachen als streng getrennter, jeweils für sich existierender Einzel-Codes, sozusagen als nicht kommunizierender Gefäße. Stattdessen hat man sie sich als Berglandschaften vorzustellen mit einzelnen Spitzen extremer Einzelfachlichkeit (z. B. in den Terminologien gewisser Fächer: Herzchirurgie, Quantenphysik, etc.), die aber aus breiten Hochebenen auftauchen, welche mehreren Disziplinen gemeinsam sind – eben die „Mittlere Schicht“ –, wobei die „allgemeine Wissenschaftssprache“ und noch weiter unten die nicht spezialisierte Allgemeinsprache als tief darunterliegende tektonische Platten zu denken sind.
Bibliographie
Blumenthal, Peter (2007): « Sciences de l’Homme vs. sciences exactes: combinatoire des mots dans la vulgarisation scientifique », in: Tutin, Agnès (ed.): Autour du lexique et de la phraséologie des écrits scientifiques = Revue française de linguistique appliquée 12/2, Paris, Publications linguistiques, 15-28.
Coxhead, Averil (1998): An academic word list, Wellington, Victoria University of Wellington.
Coxhead, Averil (2000): « A new academic word list », in: TESOL Quarterly 34/2, 213-238.
Dominique, Philippe (1971): « Vocabulaire boursier de la hausse et de la baisse », in: La linguistique 7, 55-72.
Drouin, Patrick (2007): « Identification automatique du lexique scientifique transdisciplinaire », in: Tutin, Agnès (ed.): Autour du lexique et de la phraséologie des écrits scientifiques = Revue française de linguistique appliquée 12/2, Paris, Publications linguistiques, 45-64.
Forner, Werner (1985): „Fachsprachliche Strukturen und ihre Didaktik“, in: Nehm, Ulrich/Sprengel, Konrad/AKS-Clearingstelle (eds.): Berufsorientierte Sprachausbildung an der Hochschule. Dokumentation der 14. Jahrestagung des Arbeitskreises der Sprachenzentren, Sprachlehrinstitute und Fremdspracheninstitute, Dortmund, 5.-6. Oktober 1984, Bochum, Ruhr-Universität, 204-230.
Forner, Werner (1988): „Fachübergreifende Fachsprachenvermittlung: Gegenstand und methodische Analyse“, in: Kalverkämper, Hartwig (ed.): Fachsprachen in der Romania, Tübingen, Gunter Narr, 194-217 (FFF 8).
Forner, Werner (1994): „Sinnstrukturen“, in: Schaeder, Burkhard (ed.): Fachsprachen und Fachkommunikation in Forschung, Lehre und beruflicher Praxis, Essen, Die blaue Eule, 65-81.
Forner, Werner (1996): « Au-delà des différences: L’invariance transculturelle de la variation linguistique », in: Schumacher, Alois (ed.): Les enjeux de la communication interculturelle. Actes de la semaine européenne du 13 au 17 novembre 1995, Créteil, CERE, 520-540.
Forner, Werner (1998): Fachsprachliche Aufbaugrammatik Französisch. Mit praktischen Übungen, Wilhelmsfeld, Egert.
Forner, Werner (2000): „Einige Vorurteile über Fachsprache“, in: Dahmen, Wolfgang/Holtus, Günter/Kramer, Johannes/Metzeltin, Michael/Schweickhart, Wolfgang/Winkelmann, Otto (eds): Kanonbildung in der Romanistik und in den Nachbardisziplinen, Tübingen, Gunter Narr, 321-362.
Forner, Werner (2006): „Prinzipien der Funktionalstilistik. Les principes de la stylistique fonctionnelle“, in: Ernst, Gerhard/Gleßgen, Martin-Dietrich (eds): Romanische Sprachgeschichte. Histoire linguistique de la Romania, Berlin/New York, de Gruyter, 1907-1923 (HSK 23.2).
Frame semantics (2013): „Frame semantics“, in: Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Frame_semantics_(linguistics) [12/06/2013].
Gabillon, Roland (2009): « Course cycliste, sport… d’entraide ? », in: Cycle sud. Les chroniques cyclistes, www.cyclesud.fr/chroniques/aspiration.html [15/07/2013].
Hennet, Heidi/Gil, Alberto (1992): „Kreative und konventionelle Metaphern in der spanischen Wirtschaftssprache der Tagespresse“, in: Lebende Sprachen 37/1, 30-32.
Hoffmann, Lothar (21984): Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung, Berlin, Akademie.
Hübler, Axel (1989): „On metaphors related to the stock market: Who lives by them?”, in: LAUD Papers Series C, Paper N° 19, Duisburg, LAUD.
Jäkel, Olaf (1994): „Wirtschaftswachstum oder Wir steigern das Bruttosozialprodukt: Quantitäts-Metaphern aus der Ökonomie-Domäne“, in: Bungarten, Theo (ed.): Unternehmenskommunikation. Linguistische Analysen und Beschreibungen, Tostedt, Attikon, 84-101.
Jäkel, Olaf (2003): Wie Metaphern Wissen schaffen. Die kognitive Metapherntheorie und ihre Anwendung in Modell-Analysen der Diskursbereiche Geistestätigkeit, Wirtschaft, Wissenschaft und Religion, Hamburg, Verlag Dr. Kovač (Philologia 59).
Koch, Peter/Oesterreicher, Wulf (1990): Gesprochene Sprache in der Romania: Französisch, Italienisch, Spanisch, Tübingen, Niemeyer.
Koller, Veronika (2004): Metaphor and gender in business media discourse. A critical cognitive study, Houndmills, Basingstoke/New York, Palgrave McMillan.
Lakoff, George/Johnson, Mark (1980): Metaphors we live by, Chicago (Ill.), University of Chicago Press.
Lavric, Eva (1998): „Quantitative Ausdrücke im Wirtschaftsfranzösischen“, in: Rainer, Franz/Stegu, Martin (eds): Wirtschaftssprache: Anglistische, germanistische, romanistische und slawistische Beiträge. Gewidmet Peter Schifko zum 60. Geburtstag, Frankfurt