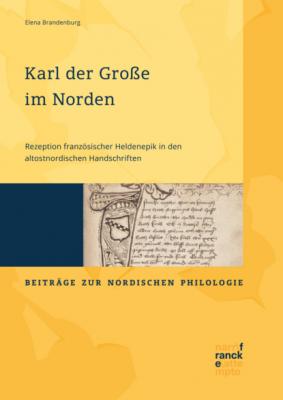ТОП просматриваемых книг сайта:
Karl der Große im Norden. Elena Brandenburg
Читать онлайн.Название Karl der Große im Norden
Год выпуска 0
isbn 9783772004681
Автор произведения Elena Brandenburg
Жанр Документальная литература
Серия Beiträge zur nordischen Philologie
Издательство Bookwire
Hákon IV. Hákonarson repräsentiert einen neuen Herrschertypus des 13. Jahrhunderts: Als gebildeter und weitblickender Mann schaffte er es, neben den positiven innenpolitischen Ereignissen wie Konsolidierung Norwegens und Etablierung dauerhaften Friedens, Norwegen gegenüber kontinentaleuropäischen Einflüssen zu öffnen, um so das norwegische Publikum mit den zentralen literarischen Figuren und Thematiken Kontinentaleuropas vertraut zu machen. Obwohl seine Kulturagenda auch harschen Urteilen ausgesetzt war – als Beispiel dient Hans E. Kincks Essay Storhetstid, in dem Hákons Übersetzungspolitik als „oppløysningsfenomen“13 bezeichnet wird, stellen die literarischen Adaptionen dieser Zeit ein herausragendes Beispiel für den kulturellen Austausch zwischen unterschiedlichen Gesellschaften und Kulturen dar. Dass die literarischen Übertragungen der altfranzösischen und anglonormannischen höfischen Dichtung in Norwegen und später in Schweden und Dänemark nicht nur passiv rezipiert wurden, sondern im neuen Umfeld auch weitergeführt und so zur Entstehung einer neuen Gattung der Märchensagas beigetragen haben, entspricht dem, was zuvor als Kulturtransfer definiert wurde: eine produktive Adaption und Reproduktion des Importierten im neuen sozialen und kulturellen System. Als Initiator dieses Kulturtransfers in Norwegen des 13. Jahrhunderts steht eben jener norwegische Herrscher Hákon Hákonarson mit seiner Kulturpolitik.
Auch wenn die Karlamagnús sagaKarlamagnús saga ok kappa hans aufgrund ihrer Herkunft aus der heldenepischen Tradition als solche keinen genuinen ritterlich-höfischen Roman darstellt, so ist nach Susanne Kramarz-Bein im Hinblick auf das Rezeptionsmilieu die Zugehörigkeit zum Umfeld des norwegischen Hofes und kulturellen Milieu Hákons Hákonarson evident. Hierfür spricht zum einen die Datierung der nicht vollständig erhaltenen, aber ursprünglicheren α-Redaktion auf das Jahr vor bzw. um 1250Þiðreks saga af Bern14 als auch der intensive Gebrauch von literarischen Modewörtern der übersetzten riddarasögurriddarasögur, so dass die Saga zumindest auf lexikalischer Ebene Züge der übersetzten höfischen Literatur trägt.Þiðreks saga af Bern15 Unter dieser Prämisse ist es daher nachvollziehbar, dass die Frage nach dem Übersetzungs- und Aufzeichnungsinteresse der Karlsepik im altwestnordischen bzw. altnorwegischen Literatursystem mit dem Potenzial dieser Texte, ein „literarisches Identifikationsangebot“16 für Hákon Hákonarson zu liefern, beantwortet werden kann.
3.2. Karl Magnus und Schweden im 15. Jahrhundert
Die altwestnordische Karlamagnús sagaKarlamagnús saga ok kappa hans gilt als die Hauptvorlage bei der altschwedischen Bearbeitung des Stoffes um Karl den Großen. Ob sie auch die einzige war, kann nicht mehr zweifelsfrei beurteilt werden: Von den insgesamt zehn Episoden (þættir) der Saga sind in der altschwedischen Version gerade einmal zwei erhalten. Die in der Forschung geäußerte Hypothese, dass es eine umfangreichere, vollständige schwedische Version gegeben haben muss, lässt sich nicht weiter verifizieren. Die Inklusion des Textes Karl Magnus in die vier der wichtigsten schwedischen SammelhandschriftenSammelhandschrift des 15. Jahrhunderts zeugt jedoch vom Interesse und der Aktualität der Karlsdichtung für den schwedischen Literaturbetrieb dieser Zeit. Anhand eines historischen Abrisses wird im Folgenden der historisch-politische Kontext, in dem die Sammelhandschriften angefertigt wurden, beleuchtet werden, um so das politische, geistige und ästhetische Umfeld der schwedischen Übersetzer/ Redaktor und Kompilatoren der Handschriften zu konturieren.
Die Entstehungszeit der vier schwedischen SammelhandschriftenSammelhandschrift, Cod. Holm. D4Cod. Holm. D4, Cod. Holm. D4aCod. Holm. D4a, Cod. Holm. D3Cod. Holm. D3, AM 191 fol.AM 191 fol., fällt in die Periode der Kalmarer UnionKalmarer Union (1397–1523), obwohl man davon ausgehen kann, dass die Texte, die in den Handschriften überliefert sind, teilweise schon früher übersetzt wurden. Die Tatsache, dass diese Texte auch 100–150 Jahre nach ihrer Übersetzung – das gilt vor allem für die EufemiavisorEufemiavisor, deren Übersetzung ins Schwedische Anfang des 14. Jahrhunderts in Auftrag gegeben wurde – in den Handschriften enthalten sind, zeugt von ihren ästhetischen Qualitäten wie von einer Aktualität, welche vor dem Hintergrund der politischen und soziokulturellen Entwicklungen in Schweden zu Zeiten der Kalmarer Union verstanden werden kann. Auch die Wahl der Texte, ihre Platzierung innerhalb der Handschriften und die gemeinsame Tradierung können im Hinblick auf das Rezeptionsmilieu als intendiert betrachtet werden. In diesem Zusammenhang wird der Frage nachgegangen, inwiefern Sammelhandschriften als Zeugnis „for cultural exchange and identity formation by concentrating on the contextualisation and re-contextualisation“1 betrachtet werden können.
Die Zeit der Kalmarer UnionKalmarer Union wurde in der norwegischen, schwedischen und dänischen Forschung unter verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und kontrovers diskutiert. Im Folgenden werden die relevanten historischen Persönlichkeiten und Begebenheiten dieser Zeit präsentiert, die zur Einordnung und Interpretation der Texte der vier SammelhandschriftenSammelhandschrift beitragen können.
Als Wegbereiterin der Kalmarer UnionKalmarer Union gilt Margarete I., die als Tochter des dänischen Königs Waldemar Atterdag und Ehefrau des norwegischen Königs Hákon VI. Magnússon ohnehin die innernordischen dynastischen Verbindungen verkörperte. Nach dem Tod ihres Vaters 1375 wurden Margaretes „unionistische Bestrebungen“Kalmarer Union2 deutlich, als sie sich auch als schwedische Königin titulierte. Nach dem Tod ihres Mannes im Jahre 1380 wurde ihr Sohn Olaf als letzter männlicher Vertreter der Dynastie der folkungar König von Norwegen, starb aber sieben Jahre später. Daraufhin gelang es Margarete, sich durch die Adoption ihres Großneffen Bogislaw von Pommern-Stolp, der später den nordischen Königsnamen Erich bzw. Erik annahm, gegen die zurecht bestehenden Ansprüche der Mecklenburger auf die schwedische Krone durchzusetzen.3 Die politisch-dynastische Stabilisierung durch Margarete ermöglichte auch den Sturz des schwedischen Königs Albrecht III. von Mecklenburg (Regierungszeit 1368–1383), der in Schweden ohnehin keine starke Stellung hatte.Kalmarer Union4 Albrechts schwache Position resultierte aus seinen Bestrebungen, sich eine zuverlässige Anhängerschaft aus den heimischen Adligen zu schaffen, mit deren Hilfe er sich in Schweden behaupten wollte. Für diese adligen Einwanderer standen finanzielle Vorteile ebenso wie herausragende politische Stellungen in Aussicht, was für Unmut seitens der schwedischen Aristokraten als auch Bauern sorgte, die über hohe Abgaben klagten.
In dieser politisch angespannten Atmosphäre gegenüber dem deutschstämmigen König war es, als der siebzehnjährige König Olaf von Norwegen und Dänemark, Sohn von Margarete und Hákon Magnusson 1387 starb, für Albrecht nahezu unmöglich, seine faktisch bestehenden Ansprüche auf die beiden Reiche durchzusetzen; denn Margarete ließ sich in die verfassungsrechtlich nicht vorgesehene Stellung eines weiblichen Königs erheben.5 Bald darauf verhandelte sie schon mit den Vertretern der schwedischen Aristokratie darüber, auch zur Königin des schwedischen Reiches zu werden. Durch eine gemeinnordische Regentin versprach sich der schwedische Adel eine stärkere Position und die Rückgewinnung des schwedischen Besitzes, welche