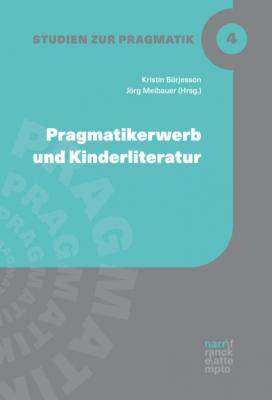ТОП просматриваемых книг сайта:
Pragmatikerwerb und Kinderliteratur. Группа авторов
Читать онлайн.Название Pragmatikerwerb und Kinderliteratur
Год выпуска 0
isbn 9783823303183
Автор произведения Группа авторов
Жанр Документальная литература
Серия Studien zur Pragmatik
Издательство Bookwire
„Och, wenn’s nur das ist, das kriegen wir schon hin. Dann fangen wir also am besten ganz von vorne an. Zwei mal zwei ist?“
„Hey, das ist nicht fair! Du wolltest doch ganz von vorne anfangen! Was ist eine Zwei?“
„Wenn du alle Pamela-Anderson-Brüste in Vinnies Bude zusammenzählst und die dann durch zwei teilst, weißt du, wie viele Poster er von ihr hat.“
„Ach so, diese Zwei, okay, alles klar. Und was ist mit der anderen Zwei?“
„Ich seh schon, das wird länger dauern.“
„Soll ich dir ein Snickers holen?“
„Ein Snickers?“
„Na, du weißt doch: wenn’s denn mal wieder länger dauert.“ (ebd.: 24)
Für verbalen Humor wurde in der Entwicklungspsychologie gezeigt, dass die Fähigkeit, diesen zu verstehen, erst ca. ab dem 7. Lebensjahr vorhanden ist, wenn Kinder anfangen, Mehrdeutigkeit in der Sprache wahrzunehmen (vgl. McGhee 1979, 1989). Wie sich diese Fähigkeit im Einzelnen auch nach dem 7. Lebensjahr noch weiterentwickelt und ob es hier auch Unterschiede bzgl. unterschiedlicher Arten von Humor gibt, ist bisher kaum erforscht. Das gilt umso mehr für literarischen Humor (siehe aber Shannon 1999). Da das Humorverständnis eng mit der Fähigkeit zusammenhängt, andere Formen der „Unaufrichtigkeit“ (zum Beispiel beim Lügen) zu verstehen, kann man von ersterem nur sagen, dass es vollständig erworben ist, wenn ein Sprecher-Hörer in der Lage ist, zwischen den verschiedenen Formen der Unaufrichtigkeit angemessen zu unterscheiden. Kinderliterarische Texte bieten auch für die Schulung der Wahrnehmung derartiger Unterschiede vielfältige Situationen.
Auch die (Un-)Höflichkeit ist ein pragmatisches System, das in den letzten Jahren intensiv erforscht wurde. Im Deutschen gibt es Besonderheiten durch das System des Duzens und Siezens. Es ist bekannt, dass die entsprechenden Regeln von Kindern erst nach und nach erlernt werden. Kinderliteratur kann Hinweise darüber geben, in welchen Situationen Sprecher(innen) mit bestimmten sozialen Rollen höflich oder auch unhöflich agieren (vgl. z. B. Pleyer 2019). So spricht der Löwe in Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte (Baltscheit 2002) die anderen Tiere im Dschungel mit „Du“ an und fordert sie nach einander auf, einen Brief an die unbekannte Löwin zu schreiben. Die Tiere kommen dieser Aufforderung nach und sprechen die fremde Löwin in ihren Briefen mehrheitlich mit „Sie“ an. Im Buch Die Heuboden-Bande. Ein Huhn in geheimer Mission (Heger/Rupp 2020) wird einer der Protagonisten – Herr Schulz, der Hund – als „Profischnüffler mit feinen Manieren und superguten Ohren“ eingeführt (rechte Seite des Vorsatzpapiers). Neben einem sehr ausgewählten Ausdruck, den er zeigt, spricht er die anderen Protagonisten auch mit „Sie“ an, während diese „Du“ zu ihm sagen.
Nicht alle Jugendlichen sprechen sog. Jugendsprache. Diese wird aber gerne benutzt, um Jugendliche zu charakterisieren. Auch wenn dies nicht authentisch gelingt, können solche Jugendliche, die über keine entsprechenden Register verfügen, jugendsprachliche Redeweisen zur Kenntnis nehmen oder sich sogar aneignen.
Schließlich bietet Kinderliteratur auch einen Zugang zu bestimmten Dialogtypen, zum Beispiel der Vorwurf/Rechtfertigungs-Interaktion oder einem Gespräch zwischen Liebenden. Man kann vermuten, dass entsprechende Dialoge so modelliert werden, dass sie typische Eigenschaften solcher Dialogtypen enthalten.
Zu nennen sind auch die verschiedenen Verfahren der Redewiedergabe, zum Beispiel die der direkten, der indirekten und der gemischten Redewiedergabe. Die Kinderliteratur enthält hier ein reichhaltiges Input-Angebot (siehe Kümmerling-Meibauer/Meibauer 2015).
Mit dieser Skizze sind natürlich nicht alle pragmatischen Phänomene erfasst. Man muss hier insbesondere auch an die lexikalische Pragmatik denken, zum Beispiel an die Pragmatik von Modalpartikeln, Interjektionen, Ausdrücke der Emotion und der Einstellung und vieles mehr. Aber auch für den Erwerb kohäsiver Mittel und die Entwicklung des Verständnisses von Diskurstrukturen im Allgemeinen kann angenommen werden, dass Kinderliteratur eine Rolle spielt. Einschlägig sind hier auch Verfahren der Einführung von Diskursreferenten (Gressnich 2011).
Was den Zusammenhang von sprachlichen Eigenschaften der Kinderliteratur im Allgemeinen und dem Erwerb sprachlicher Phänomene und Kompetenzen angeht, liegen bisher nur wenige empirische Untersuchungen vor. Das gilt umso mehr für die oben genannten pragmatischen Phänomene und Kompetenzen.
In den oben schon erwähnten Studien von Stark (2016) und Lehmden et al. (2013) ließ sich ein Zusammenhang zwischen den sprachlichen Eigenschaften der beim Vorlesen eingesetzten Kinderliteratur auf den Erwerb bestimmter sprachlicher Phänomene (in diesem Fall Präteritum bzw. Passivkonstruktionen) feststellen. Müller/Stark (2015) haben die sprachliche Beschaffenheit ausgewählter kinderliterarischer Bücher genauer unter die Lupe genommen, um für den Zweitspracherwerbskontext passende Literatur für verschiedene Sprachlernbereiche zu identifizieren. Dabei berücksichtigen sie die Bereiche Wortschatz, Phonologie, Morphologie, Syntax, Erzählen und Schriftsprache und Frühes Schreiben. Gawlitzek (2013) analysiert eine Reihe von deutschen und englischen Kinderbüchern (der Altersgruppen ab 2 bis ab 6 Jahren) hinsichtlich ihrer Komplexität (gemessen in Wörter pro Satz), der vorkommenden Satzfunktionen sowie der verwendeten syntaktischen Strukturen. Ziel ist es, herauszufinden, ob Kinderliteratur zum Erwerb der kognitiv-akademischen Sprachfähigkeit (CALP) beitragen kann.
Eine weitere Ausnahme bildet die schon erwähnte Untersuchung von Finkbeiner (2011), die mit ihrer Analyse zweier Bücher von Otfried Preußler zur Beantwortung der oben gestellten Frage, welche Eigenschaften es sind, die kinderliterarische Texte als spezifischen Input für den weiterführenden Spracherwerb kennzeichnen bezüglich des Phrasems beigetragen hat. Sie analysierte Die kleine Hexe (ein Kinderbuch) und Krabat (ein Buch für Jugendliche) hinsichtlich des Vorkommens von Phrasemen sowie potenzieller Verständnishilfen für diese. Insbesondere überprüfte Finkbeiner unter anderem folgende Thesen: Erstens sind die Phrasemarten, die sich in Büchern für (junge) Kinder finden, semantisch und pragmatisch „leichter“ zu verstehen als solche in Jugendbüchern. Zweitens werden mehr Phraseme in Kinderbüchern als in Jugendbüchern von einer Art „Prozedur der Verständlichmachung“ begleitet (vgl. Finkbeiner 2011: 70). Ihre Ergebnisse bestätigen diese beiden Hypothesen.
4 Pragmatik, Didaktik und Schulunterricht
Das Vorlesen in didaktischen Zusammenhängen muss gesondert untersucht werden. Schon im Kindergarten wird vorgelesen, aber hier steht die Vorleserin oft einer Gruppe von Kindern gegenüber und es gibt möglicherweise Probleme bei der nötigen Aufmerksamkeit und entsprechend bei der Feinanpassung. Mit dem Erwerb der Fähigkeit zum Lesen und Schreiben verliert das Vorlesen im Verlauf der Grundschulzeit nach und nach an Bedeutung, da die Kinder zunehmend in der Lage sind, sich literarische und sachbezogene Texte selbst zu erschließen. Dennoch gibt es auch hier das Format des Vorlesens, sei es, dass der Lehrer oder die Lehrerin vorlesen, oder dass die Kinder selbst als Vorleser(innen) agieren müssen. Das Vorlesen ist für Anfänger(innen) eine schwierige, riskante Leistung, denn die Zuhörer(innen) können direkt die Fähigkeit zum Lesen kontrollieren und bewerten und haben auch unmittelbaren Zugang zu begleitenden Affekten.
Insgesamt bleibt das Vorlesen gerade in der Grundschulzeit ein wichtiges Unterrichtsformat, insbesondere als Ausgangsbasis für das (weiterführende) literarische Lernen der Kinder (vgl. Kruse 2007, Spinner 2004, 2006). Insofern ist aus pädagogischer Sicht die Frage interessant, ob ein derartig etabliertes Format des Literaturunterrichts nicht auch für die Ziele des Sprachunterrichts (insbesondere des sprachlichen Lernens sowie der Entwicklung von Sprachbewusstheit) genutzt werden kann. Für den Zusammenhang von Pragmatikerwerb und Kinderliteratur ist wiederum die Frage interessant, inwieweit schulische Vorlesegespräche zum Erwerb pragmatischer Kompetenzen beitragen können.
Für den Erstleseunterricht und das literarische Lernen bieten sich in der Grundschulzeit sog. herausfordernde Bilderbücher (‚challenging picturebooks‘) besonders an. Dies können textlose oder texthaltige Bilderbücher sein. In vielen Studien hat man nachweisen können, dass dieser Bilderbuchtyp eine Kommunikation