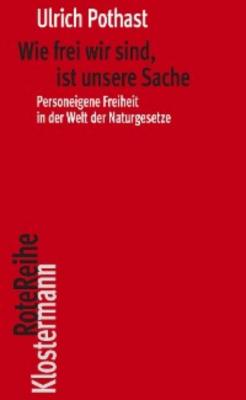ТОП просматриваемых книг сайта:
Wie frei wir sind, ist unsere Sache. Ulrich Pothast
Читать онлайн.Название Wie frei wir sind, ist unsere Sache
Год выпуска 0
isbn 9783465242734
Автор произведения Ulrich Pothast
Жанр Афоризмы и цитаты
Издательство Автор
Auch die temporären Impulse, die uns – z. B. mit vorgeschobenen Gründen – manchmal anders handeln lassen, als wir es langfristig bevorzugen und billigen würden, gehören zu uns, machen uns als die Ganzheit des jeweiligen Augenblicks mit aus. Die von ihnen angeregten Taten sind demnach durchaus unsere eigenen. Dabei mag es sein, dass wir eben diese Handlungen aus situationsunabhängiger, beruhigter Perspektive im Rückblick als nicht zu uns passend und im personeigenen Sinn als unfrei ansehen. Personeigene Freiheit gegenüber unberechenbaren Impulsen und zu den Taten, die die Person situationsunabhängig, in langfristig orientierter Überlegung richtig findet, ist nie ein sicherer Besitz, sondern immer ein gefährdetes Gut.
Aber selbst wenn wir einen eigenen Entschluss im Nachhinein nicht billigen können: Im Moment seines Hervortretens aus der undurchschauten Gesamtheit zugrundeliegender Faktoren erleben wir ihn nur selten als fremd, als uns nicht zugehörig. Das Erscheinungsbild einer Person, die ihre eigenen Entscheidungen und Handlungen im gleichen Augenblick wie ein unbeteiligter Zuschauer erlebt und ihren Verlauf wie einen fremden Prozess verfolgt, tritt unter psychisch Gesunden nicht häufig auf. Auch dann zeigt es sich allenfalls kurzzeitig. Das permanente oder auch nur überwiegende Als-fremd-Erleben eigener Entscheidungen, Taten, ja des ganzen eigenen Körpers gehört in die Symptomatik der Depersonalisation. Es gehört damit in einen Bereich, den die »Normalen« als Zeichen einer »Krankheit« deuten und an die Medizin delegieren. Hingegen können wir »Normalen« es sehr wohl erleben, dass wir eine vergangene Entscheidung und die zugeordnete Tat im Nachhinein als uns fremd einschätzen und das Ganze als Versagen unserer personeigenen Freiheit beurteilen.
Am Wort »Depersonalisation« zeigt sich nebenbei etwas über unser eingebürgertes Personkonzept: Eine Person – nach gewohnter Auffassung und »normalem« Gebrauch des Begriffs – hat ein Bild von sich und ein Erleben ihrer selbst. Dazu gehört, dass sie eine ganze Reihe von Einstellungen, Akten, körperlichen wie seelischen Eigenschaften als ihr aufs Engste zugehörig erfährt. In vorderster Reihe dieser Gesamtmenge von Zugehörigem steht ihr eigener Körper, ihr eigenes Bewusstsein und – besonders intensiv als Eigenes in einer Art Kernbereich erlebt – ihr aktuelles Wollen. Der Gegensatz zwischen Meinigkeit, Aktivitätsfärbung, Zentralität des Wollens einerseits, Unverfügbarkeit eben dieses Wollens für direkten Zugriff andererseits, scheint ein Paradoxon zu sein. Das trägt immer wieder zu großer gedanklicher Spannung beim Deuten menschlicher Selbsterfahrung bei. Die scheinbare Widersprüchlichkeit zwischen jenen gegenläufigen Eigenschaften erlebten Wollens hat schon früh zu philosophischer Auseinandersetzung herausgefordert. Sie dürfte auch ein Grund dafür sein, dass selbst in Alltagskontexten die Frage, wie wir uns als freie Menschenwesen zu verstehen haben, immer wieder zu einem Thema der Selbstdeutung reflektierter Personen wurde.
Personen können sich sehr wohl nach eigenem Entschluss in Richtung auf größere personeigene Freiheit auf den Weg machen und dorthin weiterentwickeln. Dies und die dazu nötigen Einzelhandlungen geschehen jedoch nicht als Ausmerzen der Unverfügbarkeit, die für direkten Zugriff auf eigenes Wollen bestehen bleibt. Vielmehr erweitern wir unsere menschlichen Möglichkeiten z. B. mit Hilfe eigenen Überlegens und eines Handelns, das ihm zu folgen sucht. In diesem Verständnis gibt es auch ein Sich-Entwerfen menschlicher Personen auf eine bestimmte Existenzweise hin. Da perfekte Gewissheit dabei fehlt und lineares, ununterbrochenes Aufsteigen dabei kaum vorkommt, ist es sinnvoll, sich für Erwerb, Erhaltung, Verteidigung jener Existenzweise auf wiederholte Anstrengungen einzustellen. In Kosmos der Lebewesen sind nur Personen – reflektierend auf sich selbst bezogene Wesen – imstande, diese Art von Anstrengung zu leisten. Nur Personen können eigene Handlungsneigungen ausdrücklich zum Thema machen und mit dem Ziel der Selbstveränderung indirekte Arbeit am eigenen Selbst erbringen – denkend wie handelnd.
3. Trotz Unverfügbarkeit der Willensbildung: Wir sind die Instanz, die unser Handeln wählt und ausführt
Wir sind als Personen, vielfach abhängige Wesen, in besonderer Weise daran interessiert, uns in unserem Entscheiden und Tun selbstbestimmt zu wissen. Wir sind interessiert daran, die oft zu hörende These der perfekten Vorausbestimmung all unseres Tuns durch personfremde Instanzen zurückweisen zu können. Wir sind natürlich besonders stark daran interessiert, unsere personeigene Freiheit bewahren und weiter ausdehnen zu können. Dann sehen wir uns auf einem Weg, auf dem wir dem menschlichen Ziel größtmöglicher Selbstgestaltung schrittweise näher kommen.
Eine geläufige Erkenntnis, an die wir uns auch in der Wissenschaft halten, lautet: »Was für unsere kognitiven Systeme unfassbar ist, existiert nicht für uns.«1 Wir richten uns nach dieser Erkenntnis an einer Vielzahl von Punkten, insbesondere da, wo prinzipielle Grenzen des wissenschaftlichen Zugriffs erkennbar sind. Beispiele sind die subatomare Physik und die Kosmologie. In der Physik sprechen wir von einem Indeterminismus da, wo es für uns aus prinzipiellen Gründen unmöglich ist, deterministische Verhältnisse, sicher zu erkennen. Die Frage, ob es deterministische Verhältnisse in Bereichen, die jenseits unserer Erkenntnismöglichkeiten liegen, nicht trotz allem gibt (wie einige meinen), ist keine wissenschaftlich entscheidbare Frage. Denn sie fragt nach etwas, das für wissenschaftliche Erkenntnis prinzipiell unzugänglich ist. Ähnlich verfahren wir in der Kosmologie: Zu fragen, was »vor« dem Urknall war, ist keine Frage der Wissenschaft, weil die Möglichkeiten wissenschaftlicher Erfassung, z. B. die zeitliche Ordnungsform, für uns überhaupt erst mit dem Urknall entstanden. »Vor« diesem Ereignis existiert für uns nichts, weil unsere kognitiven Systeme schon dieses »vor« nicht durch erkennenden Zugriff einlösen können.
Zwar nicht dasselbe, aber doch etwas entfernt Ähnliches gilt in sehr viel kleinerem Format für persönliche Entscheidungssituationen: Für die kognitiven Systeme der Person vor einer Entscheidung ist das Ergebnis dieser Entscheidung nicht erfassbar, solange die Entscheidung nicht gefallen und die Handlung zu Ende gebracht ist. Hermann Weyl konnte den Ausgang seines Entscheidungsprozesses prinzipiell nicht im Voraus wissen, wenn er auch im Augenblick des Aufspringens auf die Straßenbahn und des Zurufs an seine Frau das geglaubt haben mag. Angenommen, Weyl wäre Determinist gewesen und hätte das Ergebnis des Zusammenwirkens von Faktoren, die seine Entscheidung mutmaßlich »determinierten«, im Voraus wissen wollen: Dann hätte er als Wissenschaftler sich sagen müssen, dieses Ergebnis sei für seine kognitiven Systeme im Voraus prinzipiell unerfassbar. Eine »Determination« seines Entscheidungsprozesses existiere für sein Wissen solange nicht, wie dieser Prozess nicht durch eine fertige Tat (oder ein ebensolches Unterlassen) zu Ende gekommen sei. Jeder Versuch des erkennend-analysierenden Zugriffs auf den Entwicklungsprozess seiner Entscheidung hätte diesen Prozess beeinflussen können. Damit wären vermeintliche Erkenntnisse über seinen Verlauf wie auch schon jede Vermutung darüber unverlässlich geworden.
Daher war Weyl für seine Erkenntnisperspektive im gesamten Verlauf seiner Entscheidungsbemühungen allein selbst die Instanz, aus der die Entscheidung hervorgehen würde. Er stand in der persontypischen Situation unabtretbarer Wahl. Für seine Erkenntnis war seine ganze lebende Person, wie sie auf die Straßenbahn sprang und zum Telegraphenamt fuhr, der Ursprung seiner kommenden Wahl und Handlung.
Zwar erwähnt Weyl selbst äußere Umstände, die zu seiner Willensbildung beigetragen haben könnten, z. B. die freundliche Stimmung am Seeufer. Aber der Beitrag solcher Faktoren ist nur möglich, wenn sie in der Person auf etwas treffen, was durch sie beeinflussbar ist. Sonst bleiben sie irrelevant. Und Faktum sowie Größe eines solchen Beitrags sind im Zeitfenster des Entscheidungsprozesses für die Person selbst ebensowenig verlässlich erkennbar wie Verlauf und Schlusspunkt dieses ganzen Vorgangs. Im Übrigen gibt es in dem Zeitraum, in dem sich eine Entscheidung formiert, immer ungezählt viele äußere Umstände, die da sind, aber ohne Einfluss bleiben. Auch über deren Relevanz oder Irrelevanz kann sich eine Person vor ihrem Tun