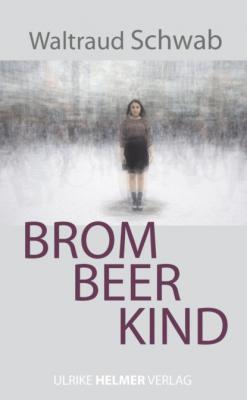ТОП просматриваемых книг сайта:
Brombeerkind. Waltraud Schwab
Читать онлайн.Название Brombeerkind
Год выпуска 0
isbn 9783897419339
Автор произведения Waltraud Schwab
Жанр Языкознание
Издательство Bookwire
Der Vater hat sie mitgenommen; oft, wenn er mit dem Fahrrad zum Sportplatz fuhr, um Fußball zu gucken; hat sie mitgenommen, wenn er an Feiertagen Durst hatte auf ein Bier im Wirtshaus, sie bekam dann eine Fanta; hat sie mitgenommen, wenn er zum Rhein fuhr, um zu angeln. Träumend saß sie im Boot, schaute dem Vater zu, der wie erstarrt schien, ein schönes Verweilen. Wird sie je gefragt, wie es sich anfühlt, wenn die Zeit stehen bleibt, wird sie antworten: Wenn man im Boot auf dem See sitzt mit jemandem, der mit ausgestrecktem Arm eine Angel hält und den man liebt. »So vergeht die Zeit bleibend.«
Da plötzlich aber wurde der Vater hektisch. Nicht sofort, es gab immer erst diesen Augenblick des Erwachens, diese leise Aufmerksamkeit, die auch sie aus ihren Träumen holte. Dann sah sie, dass sich das Wasser nicht mehr sanft kräuselte, sondern unruhig war, wie ihr Herzschlag. Und sie sah, wie der Vater den Fisch an seiner Angel fast zärtlich überlistete, ihn aus dem Wasser zog, dabei die Augen aufriss, als spreche er mit dem Fisch, als entschuldige er sich, weil die aufgerissenen Augen doch auch Erschrecken waren, Erschrecken vor der eigenen Bereitschaft, einer Kreatur den Kampf anzusagen, die ihm nichts getan hat. Oder machte er dem Fisch von Angesicht zu Angesicht doch klar, wer der Stärkere ist, wer verloren hat, wer sich in sein Schicksal fügen müsse, denn auf einmal veränderte sich sein Gesicht, er schien zu lachen, den Mund öffnete er dafür nur auf einer Seite, im Mundwinkel auf der anderen klebte die erloschene Zigarette.
Einmal nahm der Vater auch ihren jüngeren Bruder mit ins Boot. Nicht dass sie das toll fand, sie wäre lieber mit dem Vater alleine dort gewesen, nur so war träumen möglich. Der Bruder verstand nicht, wieso er still sitzen soll, verstand die Magie des Nichtstuns nicht. Und dann passiert es: Gerade als es am schönsten ist, wird der Bruder unruhig, steht auf, sagt, er will jetzt Fußball spielen, kickt gegen die Bootswand, das Boot schwankt, der Bruder kippt auf die Seite, das Boot neigt sich, er fällt ins Wasser. Sie will noch nach ihm greifen, erwischt ihn, verliert selbst das Gleichgewicht und fällt hinterher. Beide können nicht schwimmen, beide versinken.
Der Vater lässt die Angel fallen, springt in den Fluss. Zuerst packt er ihren Bruder und zieht ihn heraus, hievt ihn ins Boot und taucht dann nach ihr. Sie fühlt sich schwebend, als könne sie fliegen. Alles sei blau gewesen wie die Luft, sagt sie später, als wäre sie aufgefangen von den Elementen, »ich hatte keine Angst.« Wenn sie noch Jahre danach davon erzählt, sagt sie, dass es schön war.
Danach brachte der Vater ihr und dem Bruder das Schwimmen bei. Er stand im seichten Wasser und hielt sie, wie er auch Fische im Arm hielt, er sagte ihr, dass sie die Beine bewegen müsse, die Arme, und sie fühlte sich geborgen wie später nie wieder. Sie hätte ewig sein Fisch sein können. Aber manchmal nahm er sie an den Händen, und sie musste mit den Beinen schlagen, ohne den Boden zu berühren. Als sie es schon besser konnte, hielt er sie an den Beinen, und sie schwamm mit den Armen, wissend, dass sie nicht fortkommen kann. Erst als sie und auch ihr Bruder schwimmen können, dürfen sie wieder mit ins Boot. Aber so schön wie zuvor war es nie mehr.
Warum der Vater sie zurückgelassen hat, wo sie doch eins waren, wenn sie angeln gingen, das hat sie nicht verstanden. Anders als ihre Mutter aber lässt sie seine Abwesenheit nicht gelten. Sie wird wütend auf ihn. Und weil er nicht da ist, schlägt sie in ihrer Wut auf alles ein, erst auf Kissen, dann auf die Wände, dann auf die Möbel, schlägt auf Türen, auf Tische, schlägt auf Teller und Schüsseln, manche gehen zu Bruch, schlägt und schlägt, schlägt zuletzt auch auf die Mutter ein, weil sie will, dass ihre Mutter so wütend auf den Vater ist wie sie, und dann schreit sie, dass der Vater böse sei, böse, und als sie lange genug geschlagen und geschrien hat, blickt sie sich um und sieht in das erschrockene Gesicht ihres Bruders und in das erloschene der Mutter.
Da verstand sie, dass sie strahlend sein muss, nicht nur für sich. Dass sie Freude in die Welt tragen muss, um irgendwo wieder ein Feuer zu entzünden, das bis in das Wohnzimmer zu Hause reicht. Sie redete mit den Leuten, sagte, dass sie schöne Kleider trügen, dass ihre Gärten schön seien, dass die Vögel schön singen. Sie dachte sich Sätze aus, die die Leute verzauberten, weil sie sie nicht ganz verstanden, wohl aber spürten, dass sich Poesie darin verbirgt, obwohl sie es nicht so hätten benennen können. »Ich möchte die Wolken fangen, geht es dir auch so?«, antwortet sie an einem heißen Sommertag auf die Frage ihres Onkels, als Langeweile über dem Dorf lag. »Lass uns Regenschleier tragen«, flüstert sie ihrer Nachbarin zu, als eine Beerdigung am Haus vorbeizog. »Du bist die Tonleiter hinaufgestiegen und hast ganz oben getanzt«, sagt sie zu Alberta, ihrer Tante, die die hellste Stimme im Dorfchor hatte.
Die Leute wiederum riefen immer noch »Das Windlicht kommt«, wenn sie sie sahen, um so das Geschehene, das Verschwinden und nicht Wiederkommen, über das nicht geredet wird, weil niemand die Worte kannte, die dafür vorgesehen sind, zu überdecken mit Freude.
Aber je älter Maria F. wurde, je mehr sich die Brüste unter ihrem Pullover abzeichneten, desto öfter sagten die Leute: »Die Windlicht kommt.« Da hörte es auf, lustig zu sein.
6
Halt, stopp! Diese Geschichte kippt schon wieder ins Traurige. Kein Mensch möchte das lesen. Sowieso Vergangenheit, selbst schöne Momente von früher halten nicht lange. Die Leute möchten Spannung in der Gegenwart, wollen zum Lachen gebracht werden, jetzt. Das ist nicht zu viel verlangt. Vielleicht mit ein paar Episoden aus der Schule in der To-go-Straße? Eine Lehrerin muss auftauchen, die sich mit der Grünäugigen und ihren Freundinnen wie auch mit den Jungs am Bolzplatz abmüht.
Frau Schreier soll die Lehrerin heißen, weil der Name einschüchtert, bei ihr aber nicht, denn Frau Schreier ist sanft und bringt die Kinder immer wieder dazu, an Wunder zu glauben. Einmal fährt sie mit ihnen vom Wedding, dem Stadtteil, wo die Farben schrill sind und sich Stimmen und Formen beißen, nach Charlottenburg, wo alles dezent ist, sahnetortig irgendwie. Weil das auch den Kindern auffällt, fragen sie dort die Lehrerin, ob sie nun in einem anderen Land seien. Frau Schreier fragt, was sie glauben, und »Ja, gebt dem Ort einen Namen«, und sie nennen es »Vielleicht-Deutschland«. Sie fragt dann weiter, wie das heißt, wo sie wohnen, der Wedding nämlich, und die Kinder fragen, ob das auch ein Land sei. Frau Schreier sagt, dass es zu einem Land gehöre, und sie sollen ihr sagen, zu welchem. »Nicht-Deutschland«, antwortet da Gülüstan, deren Namen eine andere Lehrerin zuvor zu einem Land erklärt hat.
Obwohl das jetzt nicht wirklich zum Lachen ist, ist Frau Schreier froh über die Antwort, denn sie sieht, dass Gülüstan nun auch in der Verneinung denken kann. Wenn eine es kann, kann sie den anderen in der Klasse über diese Klippe helfen. Am meisten lernen Kinder von Kindern. Sie will sich das merken, um es im Mathematikunterricht zu verwenden, wenn die negativen Zahlen – eine Herausforderung – drankommen. »Wow, Nicht-Deutschland«, sagt Nilüfer. Das grünäugige Mädchen, das sich die Fingernägel abkaut bis auf die Haut, sagt nichts.
Die Grünäugige ist jung. Deshalb glaubt sie noch, dass alle Attacken nur bis an ihr Äußeres gelangen. Ihre Zähne: bis zur Haut unter den Nägeln. Die Ohrfeige: bis zur roten Wange. Der Tod der Mutter: Gänsehaut und Tränen. Wenige. Sie schämte sich dafür. »Zu alt, um zu weinen«, hat man ihr schon Jahre zuvor gesagt. Das erklärt, warum sie nur ihre Augen aufriss, wenn sie geschlagen wurde. Der erste Kuss: Lippen und Zunge. Kein Speichel, das kommt später. Der erste Penis: hart am Inneren ihres Schenkels.
Jetzt, wo so viel über das Mädchen preisgegeben ist, kann Maria F. es nur schwer ertragen, dass sie noch nicht einmal ihren Namen kennt. Denn je öfter sie »die Grünäugige« sagt, desto abfälliger kommt es ihr vor. Wie früher, wenn sie »die Windlicht« zu ihr sagten. Das will sie doch nicht, weil Abfälligkeit vernichtet. Die Grünäugige soll aber lebendig sein, sodass die, die sie auf der Straße sehen, wenn sie ihre Geschichte kennen, ihr nicht abfällig, sondern mitfühlend begegnen, verständnisvoll.
Und dies, obwohl Mitgefühl und Verständnis keine Selbstverständlichkeiten mehr sind, das Mädchen weiß das. Sie lebt von Halbwaisenrente und Hartz IV. »Herz vier« sagen die Kinder, manchmal auch »Heart for«, das sie dann »heart4« schreiben, und das heißt doch, dass man ein offenes Herz hat für andere. Aber sogar die Grünäugige, die in ihrer Jugend noch auf nichts festgelegt ist, hat verstanden, dass »Herz vier« sie zu einer macht, die weiß, dass sie sich selbst die Nächste ist, als müsste sie