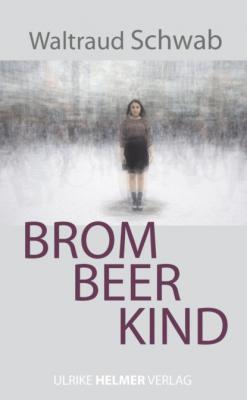ТОП просматриваемых книг сайта:
Brombeerkind. Waltraud Schwab
Читать онлайн.Название Brombeerkind
Год выпуска 0
isbn 9783897419339
Автор произведения Waltraud Schwab
Жанр Языкознание
Издательство Bookwire
Und wenn die Grünäugige ihr Handy ans Ohr hält, hört auch sie Musik. Auf diese Weise kämpft sie gegen ihre eigene Gegenwart, die ihr wie ein auf Silber servierter Schweinskopf vorkommt, den sie im Traum essen soll, obwohl es gar kein Traum ist.
Maria F. hat gelernt, sich in ein Paralleluniversum hineinzudenken, so klein, dass es auf ihrer Fingerspitze Platz hat. Nur so hat sie das durchgestanden. Jetzt ist es die Geschichte der Grünäugigen, zu der andere »Flittchen« sagen, die sie am Leben hält.
Dieses Mädchen da unten, das ist ihre Herausforderung. Wenn sie die besteht, besteht sie auch sich. Weil sie ihr Leben in einer Sackgasse sieht, wozu noch leben, kopiert sie jetzt das, was das Mädchen antreibt. Es lebt die Tage mit einer Vergessenheit, die nicht schmerzt. Jede Sekunde wie ein unwichtiger Absatz.
Jetzt, genau jetzt in diesem Augenblick gähnt die Grünäugige. Sie hält sich die Hand vor den Mund, riecht daran, riecht ihren klebrigen, süßlichen Atem. Und dann blickt sie den Mann an, der zusammen mit seinem Kumpel eine Glasscheibe vom Lieferwagen ablädt, vorsichtig die Scheibe mit einem rutschfesten Handschuh anfassend. Eine falsche Bewegung, und das Ding liegt in Scherben. Der Mann blickt zurück.
Maria F. sieht, wie die Grünäugige, nachdem sie zuvor aufs Handy geguckt hat, schon wieder grußlos geht, wie sie Nilüfer, Jasmin und die anderen sitzen lässt, so scheint es, denn sie weiß, dass das Grußlose der Gruß ist und Abschiedsgrüße gefährlich sind, weil nicht klar ist, ob es danach weitergeht.
Für einen Moment fühlt sich auch Maria F. verlassen. Sie muss den Wunsch, der Grünäugigen zu folgen, unterdrücken. Sie muss hier bleiben, in ihrem monotonen Alltag, der sie hält, ihren einfachen Gerichten, die sie nähren, Kartoffeln mit Ei, Reis mit Spinat. Kein Crescendo. Keine Höhepunkt.
Herrgott, was soll dieses Geschwafel, mit dem sie sich vor der Geschichte drückt? Ist es so schwer zu schreiben, was geschah?
Ja, ist es.
Wenn sie daran denkt, wird ihr heiß und kalt, sie schwitzt und friert, sie sieht sich im Wasser stehen, sieht sich fallen, sieht, wie das Kind fliegt. Sie hat es nicht gehalten. Tausende Male hat sie das schon durchlebt. Kann es sein, dass sie es so wollte? Sie im Wasser, sie fallend, sie das Kind loslassend.
»Ich bin schuld.«
Einmal gesagt, steht es im Raum. Schuld. Das Wort ist Gott. Danach geht es nicht weiter. Aber Maria will nicht, dass sich ihr Leben mit Gott vermischt. Maria lebt und ringt darum, dass Handlung mehr ist als Benennung. Aus dem Nichts geschah nichts. Die Handlung ist ihr Fegefeuer, in dem sie morgens aufsteht, sich im Spiegel betrachtet, sich ans Fenster stellt mit einer Tasse Kaffee in der Hand, sich die Zähne putzt, anzieht, fertig macht zum Ausgehen und dann doch zu Hause bleibt, meistens.
Nur manchmal nicht.
Es darf kein falscher Eindruck entstehen. Maria F. funktioniert. Es muss sich niemand um sie kümmern. Ihr Leben ist gesichert. Der Mann hat ihr Geld hinterlassen, und außerdem fließen jeden Monat Tantiemen auf ihr Konto. Nicht viel, aber es reicht. Sie hat früher Liebeslieder für andere geschrieben. Manchmal auch Feiertagsreden. Mitunter tut sie es noch, wenngleich nicht erfolgreich. Sie tut es nur für sich. Wenn es ihr gelingt, die Zeit zu dehnen in einem Satz, wenn sie Dinge sagt wie »Du bist mein Augenstern« oder »In den Wolken sehe ich dein Gesicht«, Sätze, die eine Öffnung ins Universum reißen (und ins Kitschige) und die ewig sind, spürt sie sich. Spürt sich endlich. Dann, in diesen seltenen Momenten, kommt sie der höheren Gewalt nahe, vor der sie sich gleichzeitig fürchtet. Denn wenn sie sich spürt, bleibt die Zeit stehen. Nur deshalb, aus Angst also, hält sie sich an der Grünäugigen fest, weil diese konkret ist und sich nicht vorstellen kann zu sein, ohne zu tun.
Sie dreht sich um, geht zurück ins Zimmer, schaut auf das Bett, die Laken zerwühlt.
4
Maria F. kann nicht im Dunkeln schlafen. Sie hat Angst vor der Nacht. Wie das kam, fragst du? Du wer? Sie kennt doch niemanden. Sie ist hierher gezogen, in diese Großstadtstraße in Berlin, wo niemand ihr über den Weg laufen kann. Kein Szenekiez, so wie da, wo sie früher wohnte. Stattdessen in den Wedding. »In den Wedding!«, riefen die Leute vor Jahren noch zu schrill, sagten: »No-Go!« Nicht zu ihr sagten sie das, aber sie weiß es aus Berichten. Auf das »No-Go« reagierten die Leute in der Straße mit einem »To go«. »To go« sagt auch sie, weil sie keine Adresse haben will, keinen Ort, wo man sie suchen kann. Sie will unauffindbar sein.
Ach herrje, unauffindbar. Zu viel Pathos ist das. Unauffindbar, wer ist das noch? Mit Kameras überall und dem Handy, dieser Nabelschnur zum Universum. Aber, um Missverständnisse gar nicht erst aufkommen zu lassen, bei Maria F. ist das keine Sache von außen, die Tarnkappe hat sie sich nicht auf den Kopf, sondern auf die Seele gesetzt. Sie will unauffindbar sein für sich selbst.
Wenn also jetzt jemand in ihre Abwesenheit hinein fragt, warum sie Angst vor der Dunkelheit hat, wo sie doch da am unsichtbarsten sein könnte, wer kann das sein? Dieser Journalist wieder, der alles von ihr wissen will? Ein Mensch mit großen Ohren, einem unverfrorenen Mund, einer kribbligen Hand, einem Stift, zwei Beinen, eins immer vor dem anderen. Fragt und fragt. So stellt sie sich das vor. Reißt eine Mauer ein und dann die nächste. Stapft mit seinen gelben Turnschuhen – der Marke »No-name«, die aus purem Understatement sehr teuer ist – über ihr baufällig zusammengeflicktes Leben. Und wenn er dann etwas zusammenschreibt, klingt es, als wäre es erfunden: »Angst vor der Dunkelheit hat sie.«
Maria F. erinnert sich jetzt an eine Freundin, die früher, als ihr Leben noch einfach war, obwohl sie schon in Berlin wohnte, in einem schäbigen Haus in der Eisenbahnstraße, bei ihr schlief. Es waren die einzigen Nächte, in denen sie wollte, dass die Vorhänge zugezogen werden, damit das Licht der Straßenlaterne, die direkt vor ihrem Fenster stand, nicht ins Zimmer fiel. Mehr noch als an die leichte Berührung der nebeneinanderliegenden Körper erinnert sie sich daran, dass es in diesen Nächten dunkel war. Sie löste sich nicht auf. Da lernte sie, dass es etwas gibt, das sie nicht kannte.
Und jetzt? Jetzt hat sie wieder in niemanden Vertrauen. Am wenigsten in sich. Wie ferngelenkt hat sie versucht, alles abzuschütteln: ihr altes Leben, den Mann, das Kind. Und dabei auch diese Freundin zurückgelassen. Sie straft sich selbst. Sogar ihre Stimme, mit der sie früher singend Menschen begeisterte, nicht weil ihr Gesang rein wäre, im Gegenteil, er ist hart und von einer kratzigen Rauheit, hat sie weggelegt, als wäre die Stimme ein Kleid, aus dem sie herausgewachsen ist.
Wie die Grünäugige versucht auch Maria F. nur noch in der Gegenwart zu leben. Heute, heute, aufstehen, sich einen Kaffee kochen, mehr kriegt sie nicht herunter so früh am Morgen, jeder Biss ins Brot ein Hammerwurf.
Darüber, ob sie überhaupt aufsteht, muss sie nicht nachdenken. Die Disziplin hat sie eingeübt, sechs Jahre lang. Noch in ihren Träumen ist aufstehen eingeschliffen. Sechs Uhr. Punkt. Und hat sie erst einmal das trockene Brot gekaut und geschluckt, langsam, ganz langsam, fängt sie an, das, was hungrig in ihr ist, erst richtig zu spüren. Sie setzt sich dann an den Tisch, nimmt das Heft, in das sie diese Geschichte hineinschreibt, die die ihre werden soll, aber jene der Grünäugigen ist, dieses Mädchens, von dem sie noch gar nicht so viel weiß, und schreibt und verwirft und schreibt.
Weil sie nicht viel über die Grünäugige weiß, schreibt sie Sätze, die sie selbst überraschen. Sätze wie den, dass die Grünäugige gläubig ist, weil sie in den Bäumen Gott sieht, eine Einsicht, die niemand ihr zutraut, nicht Taifun, nicht die Freundinnen, und die Lehrerinnen schon gar nicht. Die Grünäugige traut sich das selbst nicht zu, dennoch hört sie manchmal die Bäume sprechen. Was sie sagen, kann sie nicht in Worte fassen, deshalb ist dieses Einverständnis zwischen ihr und den Bäumen, deren Namen sie nicht einmal kennt, für sie sind Platanen, Ahorn und Birken eins, ein Geheimnis. Nur die Kastanien erkennt sie an ihren Blättern.
Und während Maria F. diese Schwäche für die Allmacht der Bäume, der die Grünäugige nachhängt, mit Worten ausmalt, weiß sie, dass sie doch nur über sich selbst schreibt. Sie, nicht die Grünäugige, sieht in den Bäumen eine Größe, die sie als etwas Wertvolles in sich birgt wie früher ihren ersten verlorenen Milchzahn,