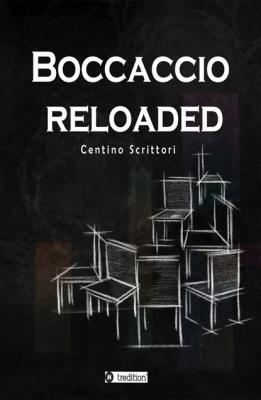ТОП просматриваемых книг сайта:
Boccaccio reloaded. Centino Scrittori
Читать онлайн.Название Boccaccio reloaded
Год выпуска 0
isbn 9783347083226
Автор произведения Centino Scrittori
Жанр Контркультура
Издательство Readbox publishing GmbH
Es war ein schöner Sonntag, als das erste Mal Bomben fielen und die ersten Menschen verletzt wurden. Wir waren zu diesem Zeitpunkt zum Glück auf einem Ausflug ans Mittelmeer. Als wir dann zurück in unsere Heimatstadt fuhren (eine Kleinstadt im Westen Syriens), war unsere Wohnung zerstört und auch meine Schule stand in Flammen. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Da uns und den Menschen aus unserer Stadt zwei Wochen zuvor der Strom abgestellt worden war, bekamen wir keine Informationen über die Lage und waren kein bisschen vorbereitet. Die erste Nacht schliefen wir dann letztendlich in unserem Auto. Wir wachten von den lauten Fahrzeugen der syrischen Armee auf. Sie befahlen uns die Stadt zu verlassen, da Terroristen diese Stadt weiter angreifen würden. Für uns war das nicht so schlimm, da wir erstens noch unser Auto hatten und zweitens unsere Wohnung schon zerstört war; außerdem hatte mein Vater schon einen Plan. Er wollte, dass wir vorübergehend zu seinem Bruder nach Damaskus ziehen, die Hauptstadt Syriens. Als wir dann aber schon fast da waren, sahen wir schon mehrere riesige Rauchwolken über der Stadt. Mein Vater beschloss jedoch weiterzufahren, um nach seinem Bruder zu sehen. Ungefähr einen Kilometer weiter versperrte uns ein Panzer den Weg. Die Soldaten sagten uns, wir sollen umkehren und probieren, das Land zu verlassen. Meine Eltern berieten sich kurz und sagten uns dann, dass wir zu unseren Großeltern nach Deutschland ziehen würden.
Wir drehten um und fuhren Richtung Norden zur syrisch-türkischen Grenze, von Damaskus aus sind das ca. 400 Kilometer. Unterwegs erklärten uns unsere Eltern, dass unsere Großeltern in Berlin einen Laden besitzen, wo sie arbeiten könnten. Als wir dann am späten Abend an der Grenze ankamen, gab es ein Riesenproblem, die Grenzwärter ließen uns nicht durch, sie sagten, wir müssen umkehren.
Das war für uns keine Möglichkeit, da wir keinen Ort in Syrien hatten, wo wir hätten hingehen können. Also fuhren wir an die Küste, um dort ein Boot zu suchen, das uns nach Europa bringen würde. Es fuhren zwei Boote nach Europa, ein Kreuzfahrtschiff, das wir uns bei Weitem nicht leisten konnten und ein großes Schlauchboot, womit aber auch viele andere Flüchtlinge die nach Europa wollten, fahren würden. Wir gingen zu den Besitzern des Bootes und erkundigten uns nach dem Preis. Sie verlangten von uns all unserer Geld und unser Auto, dazu kam, dass wir nichts mit auf das Boot nehmen durften. Somit hatten wir nur noch die Sachen, die wir bei uns trugen, und noch ein bisschen Geld, dass mein Bruder unter seiner Schuhsole versteckt hatte.
Am nächsten Morgen brachen wir sehr früh auf. In dem Schlauchboot hatten wir nur sehr wenig Platz, da es sehr voll war, wie ich bereits erwartet hatte.
Mein Vater organisierte uns drei Schwimmwesten, für mich und meine beiden Brüder. Mein ältester Bruder musste seine dann aber wieder abgeben, da es nicht genug Schwimmwesten für alle gab. Nach ungefähr zwei Stunden wurde es sehr ungemütlich, da hohe Wellen aufkamen. Eine Frau fiel ins Wasser, konnte zum Glück aber wieder ins Boot geholt werden. Wir waren den ganzen Tag unterwegs, der extrem heißen Sonne ausgesetzt und hatten kaum noch Wasser. Kurz bevor die Sonne unterging, fiel auch noch der Motor aus. Die Ersten bekamen Panik, sie könnten verdursten, ertrinken oder einen Sonnenstich bekommen. Zum Glück gab es Ruder und zwei Scheinwerfer vorne am Boot. So konnten wir die ganze Nacht lang vorankommen. Am nächsten Morgen sahen wir dann, dass das Wetter immer schlechter wurde. Die Sonne verschwand, Wolken zogen auf und es wurde windig, wodurch erneut hohe Wellen aufkamen. Nun brach Panik auf dem Schiff aus. Die Leute stritten sich um das noch übrige Wasser. Zum Glück entdeckte uns dann ein Boot der italienischen Küstenwache und nahm uns an Bord. Alles schien sich zu beruhigen, denn die Küstenwache hatte genug Wasser und sogar etwas zu essen. Doch dann kam das nächste Problem, die italienische Regierung wollte uns nicht aufnehmen und gab unserem Schiff keine Erlaubnis im Hafen anzulegen. Also mussten wir die nächsten Tage auf dem Schiff der italienischen Küstenwache verbringen. Zunächst schien das kein Problem zu sein, doch dann wurde das Essen und Trinken erneut knapp. Es drohte wieder Panik auszubrechen. Auch die Schiffscrew bekam ein wenig Panik, sie funkten andauernd den Hafen an und baten um Anlegeerlaubnis, doch der Hafen verweigerte dies. Die Lage auf dem Schiff wurde immer schlimmer, weil sich eine Grippe verbreitete. Viele der Flüchtlinge bekamen Husten und hohes Fieber. Schließlich durften die Schwerkranken an Land, um in einem Krankenhaus behandelt zu werden. Das entspannte die Situation, da nun weniger Leute auf dem Schiff waren.
Zwei Tage später kam die Erlösung, es kam eine Nachricht, dass fünf EU-Länder sich dazu bereit erklärt hätten, uns aufzunehmen. Zu diesen Ländern gehörten Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland, was für uns natürlich sehr wichtig war.
Drei Stunden später legten wir im Hafen von Neapel an. Von dort aus flog uns ein Flugzeug nach Frankfurt, eine Stadt im Süd-Westen Deutschlands. Nun mussten wir aber selbst dafür sorgen, dass wir nach Berlin kamen. Vom Flughafen aus nahmen wir eine Bahn zum Frankfurter Hauptbahnhof und kauften mit unserem Restgeld ein Zugticket nach Berlin. In Berlin angekommen holte uns mein Opa vom Bahnhof ab. Wir fuhren in einen Stadtteil namens Zehlendorf, wo der Laden meiner Großeltern war.
Am nächsten Tag fuhren wir fünf zur Einwanderungsbehörde, um einen Pass zu beantragen. Meine Eltern hatten ein bisschen Angst, dass doch noch irgendwas schiefgehen konnte und man uns wieder zurück nach Syrien schicken würde. Doch alles funktionierte und wir bekamen die Erlaubnis, in Deutschland bleiben zu können. Meine Eltern übernahmen den Laden von meinen Großeltern. Meine Brüder und ich gingen auf eine syrische Schule, nicht weit weg von unserer Wohnung.
Alles war gut und wurde immer besser, mein Onkel kam mit seiner Familie auch zu uns nach Berlin und bekam ebenfalls einen Pass. Er eröffnete eine Autowerkstatt, in der ich und mein großer Bruder nach der Schule mithalfen. Mit dem ganzen Geld, was wir verdient hatten, konnten wir uns sogar eine größere Wohnung und ein neues Auto leisten.
(Felix Zitscher)
Zehnte Geschichte
Wir sind alle froh, dass es so gut ausgegangen ist. „Wir sind schon wieder bei neun Geschichten angekommen, wollen wir heute auch nach zehn aufhören“, frage ich. „Ja, würde ich schon sagen, aber darf ich eine erzählen“, fragt ein Mädchen in einem roten Kleid. Wir stimmen alle zu und die letzte Geschichte des Tages beginnt.
Wir saßen in einer Ecke der Scheune, mit Heu bedeckt und warteten darauf, dass unser Kindermädchen Elisabeth uns finden würde, aber sie kam nicht. In der Ferne konnte man eine monotone Stimme hören und daraufhin das Schluchzen meiner Mutter. Wir kamen aus der Scheune raus und liefen in Richtung des großen Herrenhauses von Eldena, in dem meine Familie für vier Generationen gelebt hatte. Dort stand meine Mutter, die einen Brief in der Hand hielt und weinte. „Mama? Wer war das“, fragte mein Bruder Hans vorsichtig, denn wir wussten, dass das nichts Gutes heißen konnte, wenn Mama weinte, denn sie weinte nie. Sie war die stärkste Frau, die ich kannte, sie kümmerte sich immer um alle und sorgte dafür, dass wir eine tolle Kindheit hatten, während mein Vater in Berlin in der Bank saß und nie vorbeikam. Damals konnte ich nicht verstehen, dass es keine persönliche Entscheidung meines Vaters war, sondern dass er keine andere Wahl hatte, denn Berlin war abgeriegelt.
„Hans, Angelika, wie seht ihr denn aus“, fragte sie mit einem Lächeln im Gesicht, denn wir waren ja immer noch von Kopf bis Fuß mit Stroh bedeckt. „Wer war das“, fragte mein Bruder erneut. „Niemand Wichtiges. Wisst ihr, wir fahren für eine Weile zu eurer Tante, okay“, antwortete meine Mutter und schob uns in Richtung Haus. Elisabeth kam aus ihrer Stube und nahm uns mit ins Badezimmer, wo sie uns badete und anzog. „Elisabeth, Mama meinte, wir fahren zu Tantchen. Kommst du auch mit“, fragte ich sie. „Ja, wir alle kommen mit euch.“ „Alle? Das wird aber ein voller Zug“, sagte ich lachend. „Ja, voll wird es auf jeden Fall. Ich hole euch jetzt etwas von dem Apfelkuchen, den Margaret heute frisch gebacken hat“, sagte sie und ging aus dem Raum.
„Hans: warum hat Mama geweint“, fragte ich, während ich langsam begriff, dass etwas anders war, als so, wie wenn wir sonst wegfuhren. „Angie, du bist noch ein bisschen zu klein, um das zu verstehen.“ „Das ist gemein, ich bin schon fünf, also nur vier Jahre jünger als du“, entgegnete ich trotzig, denn ich hasste es, wenn alle so taten, als ob ich zu klein war, auch wenn das nicht stimmte, aus meiner Sicht der Dinge. Einen Moment später kam Elisabeth mit dem Kuchen wieder und dazu auch noch