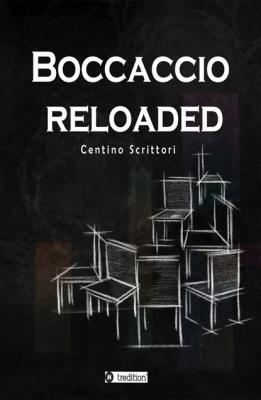ТОП просматриваемых книг сайта:
Boccaccio reloaded. Centino Scrittori
Читать онлайн.Название Boccaccio reloaded
Год выпуска 0
isbn 9783347083226
Автор произведения Centino Scrittori
Жанр Контркультура
Издательство Readbox publishing GmbH
Als Mama am Abend ins Zimmer kam, um uns ins Bett zu bringen, gab ich ihr mein Bild, und als sie es entgegennahm, konnte ich erkennen, wie sehr sie ihre Tränen zurückhielt. „Das ist das Schönste, was du jemals gemalt hast, Angelika. Ich werde es immer dabeihaben, egal was kommt.“ Sie küsste erst meinen Bruder und dann mich, löschte das Licht und ging aus dem Zimmer. In dieser Nacht träumte ich von Weihnachten, wo wir alle zusammengesessen hatten und ich meine Stifte ausgepackt hatte. Eine Karte von Papa war dabei gewesen und Hans hatte sie mir vorgelesen, und ich erinnerte mich, dass auch Papa gesagt hatte, dass was immer auch kommt diese Stifte mir helfen würden, Kraft und Farbe in jeder denkbaren Situation zu finden.
Im nächsten Moment spürte ich, das mich jemand schüttelte. Ich wachte auf und sah das erschrockene Gesicht Elisabeths über mir. „Angie, du musst aufstehen und dich schnell waschen und anziehen, okay? Es ist sehr wichtig, dass wir schnell sind.“ Noch nie zuvor hatte ich sie so eindringlich und beängstigt erlebt. Hans war gerade dabei, sich anzuziehen, und nach einem Blick wusste ich, dass auch er nicht wusste, was passierte. Unsere Schränke waren leer, die Spielsachen weggeräumt und die Koffer gepackt. Elisabeth half mir, mein Kleid anzuziehen und meinen Teddy in eine kleine Leinentasche zusammen mit einer Tüte Proviant und meiner Ausgabe von „Emil und die Detektive“, mein liebstes Buch zu dieser Zeit, einzupacken. „Wo ist Mama“, war die einzige Frage meines Bruders. „Unten mit den Anderen“, antwortete Elisabeth hastig, während sie unsere Koffer zur Tür zog und mich auch.
Wir liefen in größter Eile die Treppe hinunter und es war wirklich ein komischer Anblick. Auch wenn es ungefähr elf Uhr abends war, befand sich niemand im ganzen Haus. Normalerweise wimmelte es hier nur so von Menschen, die immer irgendetwas taten. Die Betten aus den Gästezimmern waren weg und alle anderen wichtigen Sachen auch. Das letzte Zimmer vor der Haustür war die Küche und auch sie war leer, wirklich leer, nicht nur von Menschen, sondern auch von Vorräten und Töpfen. Als wir aus dem Haus traten, bot sich uns ein ungewohnter Anblick: Einige Angestellte, nahe Verwandte und auch Leute, die ich noch nie gesehen hatte, standen vor dem Haus und beluden die Pferdekarren. Meine Mutter bildete den Mittelpunkt des Geschehens, denn sie half den Alten und Kranken auf einen einzelnen Wagen. Selbst einige der Adligen aus den benachbarten Grafschaften und die Großgrundbesitzer aus Rappenhagen oder Kreisau waren hier.
„Kinder, kommt schnell hier rüber“, rief meine Mutter uns zu und wir liefen los. Nachdem sie uns in den Arm genommen und geküsst hatte, hob sie erst mich und dann Hans auf einen Karren zu den anderen Verwandten. Es gab insgesamt drei Karren, einen mit den Alten und Kranken, einen mit der Familie und den kleinsten mit den Angestellten. Geführt wurde unser Wagen von den Lieblingstuten meiner Mutter, ein Geschenk ihrer englischen Mutter, und diese wurden kontrolliert von der Dorflehrerin Mathilde aus Bremen. Ich verstand immer noch nicht, was passierte, denn warum sollten all diese Leute mit uns zur Tante fahren? „Wir fahren nicht zu Tantchen, oder“, sagte ich zu meinem Bruder. „Es scheint nicht so zu sein. Es muss etwas mit Ihnen zu tun haben.“ Mit Ihnen oder Sie, wie Elisabeth sie nannte, das waren die Leute, wegen denen Papa nicht hier sein konnte. Aber was hatten sie mit unserer Abreise zu tun? Ich kannte sie nicht mal, keiner sagte jemals den Namen, in der Angst, ihre Aufmerksamkeit zu erlangen.
Nachdem alle auf den Karren saßen, nahm meine Mutter höchstpersönlich auf dem Bock des Krankenkarrens Platz und alle setzten sich nacheinander in Bewegung. Nicht nur ich war verwirrt, denn auch Hans guckte, als ob er nicht wüsste, was passierte. Nach einiger Zeit auf dem Karren, mit dem ungleichmäßigen, aber trotzdem rhythmischen Gerumpel über die Wege des Waldes, schlief ich auf der Schulter meines Bruders ein. Ich musste bestimmt zwei Stunden geschlafen haben, denn als ich durch ein „Stopp!“ geweckt wurde, sah die Gegend schon ganz anders aus. Wir waren an einem Stützpunkt, irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern angekommen und wurden von den Offizieren informiert, dass alle Männer zum Wehrmachtsdienst antreten sollten. Nach langen Diskussionen durften wir aber passieren, da viele von uns verwundet, krank oder schwach waren.
So ging es die ganze nächste Woche weiter, an jedem Stützpunkt dieselbe Forderung und wenn wir Glück hatten, mal hier und dort ein Dorf, das uns gewährte, für eine Nacht zu bleiben, um die Kranken zu versorgen, die Pferde zu pflegen und uns Kinder etwas spielen zu lassen. Mein Bruder bekam im Laufe der Zeit einen seltsamen Hautausschlag, den die Leute Krätze nannten, was dazu führte, dass er auf den Krankenkarren wechselte und dort ganz alleine zwischen den alten und sterbenden Leuten saß.
Es war Anfang Februar, also war es sehr kalt, und das Einzige, was uns alle wärmte, war die Tatsache, dass wir alle zusammenrückten und uns zu viert oder fünft eine Decke teilten. Meine Halsschmerzen waren immer schlimmer geworden, bis ich nicht mehr reden konnte, Schwierigkeiten beim Atmen hatte und auch hohes Fieber bekam. Bereits fünf Menschen aus unserer Gruppe waren auf der Reise an einer Lungenentzündung gestorben, weil wir ihnen nicht helfen konnten.
Sobald es meinem Bruder besser ging, fing er an, Tagebuch über unsere Ereignisse zu führen, über unser altes Leben, den Aufbruch und auch über die Zeit auf dem Weg in Richtung Hoffnung und Freiheit.
Irgendwann kamen wir endlich an der Grenze der britischen Besatzungszone an, wo unsere Karren aufgelöst wurden, die Pferde bis auf zwei weggenommen und wir alle verteilt wurden. Meine Mutter, mein Bruder, meine Tanten, ein paar unserer Angestellten und ich fuhren mit dem letzten verbliebenen Karren in Richtung des Gutes meiner Tante Karin von Barner. Nach langer Zeit ohne viel Essen, mit meiner Krankheit, weswegen ich kurz vor dem Sterben war, und der deutlich sichtbaren, emotionalen und physischen Belastung meiner Mutter freuten wir uns auf wenigstens einen Tag der Ruhe. Allein deswegen war unsere Enttäuschung umso größer, als wir dort ankamen.
„Hallo liebe Elsa, wie geht es euch denn“, fragte meine Tante als wir endlich auf dem Hof angekommen waren. „Leider nicht so gut. Angelika hat eine Lungenentzündung und unsere Vorräte sind fast leer. Aber wir sind froh, heute bei euch seien zu dürfen.“ „Ja natürlich, ich habe Agatha schon gebeten, euch den Stall herzurichten. Im Haus ist leider kein Platz mehr.“ Auch wenn meine Mutter in diesem Moment nichts sagte, war klar, wie enttäuscht und wütend sie über das Verhalten ihrer Schwester war. Karin, eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind und einem großen Haus erlaubte es sich, uns im Stall zum Schlafen unterzubringen. Viel früher als eigentlich geplant, brachen wir am nächsten Morgen wieder auf, denn meine Mutter hatte von einem nahen Lazaretthaus gehört und hoffte, dort endlich Heilung für mich zu finden. Wäre dieses Lazarett innerhalb einer anderen Besatzungszone gewesen, so hätte ich die Reise niemals zu Ende bringen können, aber wegen der englischen Abstammung und der Adelsposition meiner Mutter wurde ich letztendlich doch im Krankenhaus untersucht und behandelt.
Während ich darauf wartete, dass der Doktor mich entließ, malte ich mit meinen Buntstiften ein Bild von Emil und seinen Freunden in Berlin. Wir mussten eine ganze Woche in dem Krankenhaus bleiben, bis wir weiterfahren konnten, nach Kiel, wo meine Mutter Hans und mich in die Betreuung eines Priesters gab, während sie sich Gedanken machte, wie unsere nächsten Schritte aussehen würden. Auch wenn der Priester von meiner Mutter gut bezahlt wurde, ließ er uns fast verhungern, was besonders für mich nach einer Krankheit wie der Lungenentzündung, weshalb ich sowieso schon abgemagert war, sehr gefährlich wurde. Aber bevor dies passieren konnte, kam meine Mutter eines Morgens in das Kloster, um uns mitzuteilen, dass uns erlaubt wurde, nach Berlin zu meinem Vater zu reisen. Diesmal nahmen wir nicht den Karren, sondern den Zug. Unsere Pferde fuhren ebenfalls mit, denn meine Mutter als begnadete Reiterin konnte und wollte sie nicht zurücklassen.
Es war wunderbar, nach der ganzen Zeit auf den Pferdekarren endlich in einem Zug zu fahren und auch zu wissen, wohin man fährt.
Auch wenn die Ankunft in Berlin nicht wie ein Wunder die ganze Welt rettete, so half es zumindest uns, wieder das Gefühl von einem Zuhause zu haben. Wir lebten in einem wunderschönen Haus mit Garten und viel Platz an der Grenze zum amerikanischen Sektor in Kladow. „Mama; was ist eigentlich mit Eldena passiert“, fragte ich meine Mutter an meinem zehnten Geburtstag, denn ich hatte schon lange darüber nachgedacht, aber ich konnte es mir einfach nicht erklären. „Eldena geht es gut, aber es gehört uns nicht mehr“, sagte meine Mutter und ich konnte