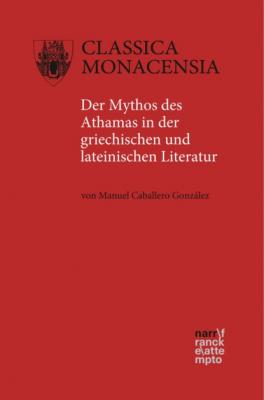ТОП просматриваемых книг сайта:
Der Mythos des Athamas in der griechischen und lateinischen Literatur. Manuel Caballero González
Читать онлайн.Название Der Mythos des Athamas in der griechischen und lateinischen Literatur
Год выпуска 0
isbn 9783823300045
Автор произведения Manuel Caballero González
Жанр Документальная литература
Серия Classica Monacensia
Издательство Bookwire
Zurück zu Ovids Textstelle muss man bemerken, dass die Erinnyen, wie echte Frauen, obwohl sie höllischer Natur sind, nicht damit aufhören können zu tun, was Frauen zu tun pflegen, wie z.B. das Haar kämmen. Hier aber sind die Haare durch gefährliche, schwarzschillernde Nattern ersetzt. Nach Paus. I 28, 6PausaniasPaus. I 28, 6 war Aischylos der erste, der von Schlangen statt Haaren schrieb. Bernbeck kritisiert die Szene: „Dadurch wird auf die Rachegöttinnen ein Zug weiblicher Eitelkeit übertragen, der zu ihrem unheimlichen Wesen nicht passen will“98; jedoch tadelt Bömer Bernbecks Kritik und schließt dies aus, „Damen, die in der Finsternis der Unterwelt ihr Haar kämmen, das aus schwarzen Schlangen besteht, wirken ‚beklemmend‘ genug“99. Padels interessante Überlegung zu der griechischen TragödieTragödie, wenn sie über Lyssa und die ErinyenErinyen im Allgemeinen spricht, ist auch für Tisiphone gültig: „Madness, supremely, is the nonhuman in the human. Madness-daemons are mainly compound, female-cum-animal figures, human and nonhuman“100. So kann man auch die ovidische Tisiphone sehen: eine weibliche, mit Schlangenhaaren beschriebene Figur. Auf jeden Fall erkennen die Erinnyen Juno aufgrund der Nebel und der Überraschung nicht sofort.
Dann schildert Ovid die Behausung, in der der Frevel begangen wurde. Bernbeck sagt, „man erwartet, daß jetzt die Rede auf Ino und die Szene dadurch zu ihrem für die weitere Handlung entscheidenden Höhepunkt kommt. Aber nein!“101; man muss noch Geduld haben und warten. Diese Beschreibung des Auernus war ein Lieblingsthema bei den Dichtern, vor allen bei den Alexandrinern. Den Titel sedes scelarata übernimmt Ovid von Tibul. I 3, 67–68: at scelerata iacet sedes in nocte profunda / abdita, quam circum flumina nigra sonant. Es ist der berühmte τόπος ἀσεβῶν. Tibull war in Messalla verliebt, weswegen er ihr sagt, dass VenusVenus sie nach dem Tode zum Elysium führen wird, wo die Liebe herrscht; die Verurteilten aber werden in diesem sedes scelarata von Tisiphone gequält. Tibull erwähnt Ixion, Tityos, Tantalos und die Danaiden. Ovid fügt – laut Anderson – etwas ausgeklügelter hinzu: „This Sedes is not simply the place of punishment for evil, as in Tibullus, but also the actual seat from which the Furies rise to greet the goddess“102.
Ovid kommt zur Liste der Autoren, die die Namen der bekannten zu unnötigen, sinnlosen Qualen Verurteilten präsentieren. Castiglioni denkt eigentlich, „l’enumerazione delle pene, l’analisi minuta delle sofferenze eterne dei miseri, e il ricordo dei più illustri dannati costituivano un luogo comune“103. Die Namen dieser Unglücklichen finden sich schon in der bekannten Episode von Od. XI 576–600HomerOd. XI 576–600, die ein Echo bei Tibull, Lukrez und Ovid selbst, nicht nur in den Metamorphosen, sondern auch in seinem Ibis haben wird. Sogar außerhalb des Kreises der Dichter wird auch ein Bild von Polygnotos über Tityos in Paus. X 29, 3PausaniasPaus. X 29, 3 beschrieben. Die von Ovid vorgeschlagene Reihenfolge lautet: Tityos, Tantalos, Sisyphos104, Ixion105 und die Danaiden, die der Dichter Beliden106 nennt. In diesem Werk aber, etwas später (MetOvidMet. X 41–44. X 41–44), wird Ovid folgende Reihenfolge vermerken: Tantalos, Ixion, Tityos107, die Danaiden und Sisyphos. In Ou. IbOvidIb. 173–180. 173–180108 wird die Reihe so dargestellt: Sisyphos, Ixion109, die Danaiden, Tantalos110 und Tityos111. „Bei allen befindet sich Tisiphone in unmittelbarer Nähe“112.
Dann geht Juno vom Auge zur Zunge. Sie beginnt ihre Rede, die dem bitteren Selbstgespräch von Verg. AenVergilAen. I 34–49. I 34–49 ähnelt. Juno beklagt sich, dass Sisyphos der einzige Aiolide sei, der unter ewiger Qual leidet; falls es nicht klar genug ist, an wen sie denkt, erwähnt sie nachstehend: Athamas. Er wird zum ersten Mal in der griechischen und lateinischen Literatur als superbus beschrieben; jedoch gibt es keinen literarischen Beleg vom Stolz des Aioliden, wie Bömer bemerkt: „Athamas gilt im allgemeinen nicht als ὑβριστής“113. Man muss annehmen, dass die von Juno bezeichnete Verachtung die Erziehung von Dionysos meint, weswegen auch Ino der Klage hinzugefügt wird. Obwohl Juno von einer Missachtung ihrer Person redet, erwähnt sie nie die echten Gründe ihrer Animosität Dionysos gegenüber.
Der reiche Palast von Athamas zeigt seinen Wohlstand. Mit Bernbeck kann man sagen, dass Junos Worte den Eindruck erwecken wollen, „als ob es ihr mehr um eine Bestrafung des Athamas als der Ino ginge, obwohl doch allein diese ihren Zorn gereizt hatte (420ff)“114.
Ovid bringt nicht den genauen Wortlaut von Juno, wohl aber den Sinn. Sie redet über den Anlass ihres Grolls – der echte Grund ihrer Reise –, von ihrer Absicht: der Zerstörung des Hauses von Kadmos – das hat mit dem Aioliden wenig zu tun – und davon, dass sie Athamas den verbrecherischen WahnsinnWahnsinn sendet. Bernbeck irrt sich m.E., wenn er sagt, „es scheint, als habe Juno ihren ursprünglichen Plan geändert“115 und denke nicht mehr an den bacchischen Wahnsinn. Meiner Meinung nach bezog sich das ipse docet von Vers 426 auf den Wahnsinn im Allgemeinen und nicht auf den bacchischen, wie die Erwähnung der tyrrhenischen Piraten zu bestätigen scheint. Interessant ist andererseits die Abwesenheit von Ino in Junos Forderung; die Göttin beruft sich nur auf KadmosKadmos und Athamas, aber es war Ino und ihr Prahlen, die Junos Groll verursachten.
Die Göttin verhält sich als Jupiters Frau (imperium), als olympische Göttin (promissa), und als eine von ihrem Mann verachtete Frau (preces). Das Verb confundit bezeichnet ganz genau die Verworrenheit ihrer von Groll und Hass motivierten Rede. Bernbeck behauptet, „diese Erzähltechnik ist in epischer Darstellung neu“116; in der Epik von Homer und Vergil werden die Reden üblicherweise buchstäblich wiedergegeben. Darüber hinaus benutzt Ovid eine provokante Technik: Er gibt die sekundären Bemerkungen von JunoJuno Wort für Wort wieder, wie z.B. die über Sisyphos, und deutet nur indirekt den Kernpunkt ihres Zornes und ihres Weges an, nämlich die Bestrafung Inos. Auffallend ist Halm-Tisserants Überlegung, wenn sie behauptet: „Conformément au champ d’action qui, dans la pensée antique, délimite les fonctions divines, Héra ne détient pourtant pas le pouvoir d’aliéner directement“117; dies ist der Grund, weshalb sie sich verschiedener Mittelspersonen, und zwar in diesem Fall einer Erinnye, bedienen muss.
Tisiphone anwortet Juno. Bömer erklärt, „die ovidische Gestalt der Tisiphone ist in unmittelbarer Konkurrenz zu Vergils Allecto konzipiert“118, wie in zwei Beispielen bei Vergil zu sehen ist: In der Aeneis bleibt Allekto immer unsichtbar (Aen. VII, 343–345VergilAen. VII 343–345)119 und auch die zu Amata geschickte Schlange kann nicht gesehen werden (Aen. VII 346–353VergilAen. VII 346–353). Ovid inszeniert Tisiphones Angriff auf eine sehr theatralische Weise, indem er die verschiedenen Motive untereinander verstärkt: Schlangen – giftiger Trank – Fackeln in Bewegung. Bömer beteuert, „das vergilische Motiv wird überhöht, variiert und verdoppelt“120. In Euripides’ Herakles gibt es auch eine Szene, die einige Kontaktpunkte dazu hat. Da erscheinen Iris und Lyssa vor Herakles’ Palast; „Iris exprime la volonté d’Héra, Lyssa doit l’exécuter“121. Der Unterschied zu Tisiphone liegt darin, dass Lyssa Heras Befehl ungern durchführt, indem sie auch ihre Sympathie für Herakles, Heras OpferOpfer, zeigt; bei Ovid willigt Tisiphone in Junos Aufforderung sofort ein, ohne sich zu zieren.
Ovid besteht ganz besonders auf der Aufregung wegen ihrer Haare122 und auf den Schlangen, die sie trägt. Anderson sieht in dieser Bewegung, wie „Ovid has wittily adapted a flamboyant move of contemporary Roman speakers“123. Bernbeck aber glaubt, „dadurch klafft zwischen Wesen und Erscheinung der Furie ein Widerspruch und ergibt wieder den Reiz der unangemessenen Vorstellung“124; seine Behauptung ist m.E. ein bisschen übertrieben. Die Erinnye ist direkt: sie braucht keine Umschweife125. Gesagt, getan (facta puta); auf diese Art wird Juno auch mit den sidonischen Gefährtinnen von Ino (Res dicta secuta est, Vers 550) umgegangen sein. Sie ermahnt die olympische Göttin, zur himmlischen Wohnung zurückzugehen; das heißt, sie muss die von ihr selbst gebrochene Ordnung wiederherstellen.
Juno