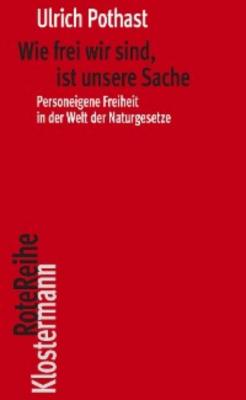ТОП просматриваемых книг сайта:
Wie frei wir sind, ist unsere Sache. Ulrich Pothast
Читать онлайн.Название Wie frei wir sind, ist unsere Sache
Год выпуска 0
isbn 9783465242734
Автор произведения Ulrich Pothast
Жанр Афоризмы и цитаты
Издательство Автор
Personeigene Freiheit zeigt sich in konkreten Situationen des Lebens als Freiheit gegenüber dem Druck temporärer Impulse und Freiheit zu den Handlungsweisen, die die Person bei situationsunabhängiger Überlegung von sich her billigt und als eigene Handlungsweisen will. Da absichtsvolles Unterlassen auch als Handeln gelten kann, ist solches Unterlassen überall da, wo hier von »Handeln« gesprochen wird, mit einbegriffen. Ja, mögliches Unterlassen und Nicht-Unterlassen-Können spielen im Kontext rechtlich relevanter Verfehlungen bis hin zur Kriminalität sogar eine vorrangige Rolle. Beides, frei wie unfrei im jetzigen Verständnis, sind wir nicht dauerhaft und für alle Zeit voraussagbar. Vielmehr sind wir beides immer mit einem unbestimmten Grad von Veränderlichkeit, der sich negativ wie positiv jederzeit bemerkbar machen kann.
Der General Balaschow besaß vor Napoleon sehr wohl die oft beschworene Freiheit des Handelns. Nichts in Tolstois Darstellung lässt darauf schließen, dass es äußere Umstände gab, die ihn am Ausführen seines Befehls gehindert hätten. Trotzdem heißt es, »Er konnte diese Worte nicht sagen«. Er besaß in diesem Augenblick nicht die personeigene Freiheit, die nötig gewesen wäre, um sich über das erwähnte »Gefühl« hinwegzusetzen und seine Pflicht zu tun. Stattdessen macht er von seiner Freiheit des Handelns eben den Gebrauch, der in ihrem Begriff liegt: Er tat, was er genau in diesem Augenblick tun wollte. Das heißt, er tat, was ein momentanes, in einem Sekundenbruchteil entstandenes, quasi feigeres Wollen gerade jetzt wollte, und sprach den schwächeren Satz. Wir können als sicher annehmen, dass sich der General über dieses momentane Wollen nicht schon zum gleichen Zeitpunkt Klarheit verschaffte. Tolstois Schilderung klingt, als überlegte Balaschow gar nicht, sondern handelte, das heißt sprach – nur sprach er das Falsche. Jenes »feigere« Wollen war trotz fehlender Überlegung gewiss ein Wollen. Denn es erlangte Wirksamkeit im Handeln, das heißt im Sprechen des Generals, und der General ist dafür Rechenschaft schuldig. Handlungswirksamkeit, alias Handlungseffizienz, ist das unterscheidende Merkmal des Wollens gegenüber bloßem Lieber-Mögen, Phantasieren, Sich-Erträumen und so fort.
Wie wichtig, ja wie unendlich kostbar die Freiheit des Handelns als Nicht-Gezwungenwerden für Menschen auch sein mag: Sie erscheint ebenso trivial wie nutzlos, wenn ein Handelnder temporär auftretenden Impulsen verschiedener Art, die er im Prinzip selbst missbilligt, nicht widerstehen kann. Solche Impulse müssen nicht als Zwänge äußerer oder innerer Art erlebt werden. Vielmehr machen sie sich zu dem Zeitpunkt, zu dem die Person von ihnen bedrängt wird, als eigene Wünsche oder sonstige Antriebe der Person selbst geltend. Sie treten gerade nicht notwendig als personfremde, eine Handlung erzwingende oder verhindernde Faktoren auf. Vielmehr treten sie auf als zeitweiliges, von der Person oft gar nicht als bloß zeitweilig erkanntes, durchaus ihr zugehöriges Hinstreben zu bestimmten Handlungen. Bildet sich dann ein Wollen im Sinn dieses Hinstrebens, so tut die Person, was sie kurzfristig will, zeigt also Freiheit des Handelns. Und doch kann es sein, dass sie dieses Tun als einen Fall von Unfreiheit ansieht, wenn der temporäre Druck nachgelassen hat und sie in Ruhe über sich nachdenken kann. Die personeigene Freiheit dieses Menschen war nicht hinreichend stark, um in der konkreten Situation die Handlungslinie durchzuhalten, die er sich bei beruhigter Überlegung, unbedrängt vom Druck und Zug solcher Lebenslagen, zurechtgelegt hat.
Das Auftreten impulsiver Regungen ist dabei nicht als Eingriff fremder Mächte in die personale Existenz zu verstehen, sondern ereignet sich als Konflikt in der Person selbst. Die Annahme, dass Personen allein von plötzlich auftretenden äußeren Motiven, die z. B. als Reize auf sie einwirken, zum Handeln gebracht werden, ist irreführend und in der Regel falsch. Menschen nehmen jeden Tag unabsehbar viele äußere Gegebenheiten wahr, die im Prinzip geeignet wären, einen Anreiz zum Handeln zu liefern. Das menschliche Leben, besonders in seiner modernen Gestalt, ist dem ständigen Herumgehen in einem Kaufhaus ähnlich. Die Menge möglicher Gegenstände, die dort zum Kauf reizen könnten, ist riesig, aber nur wenige davon üben auf die Person tatsächlich einen Kaufreiz aus. Welche Gegenstände das sind, hängt nicht primär von diesen Gegenständen ab. Es hängt ab von den Interessen und Neigungen der Person, die die Gegenstände wahrnimmt. Durch diese Interessen und Neigungen erst entsteht eine Auswahl unter den zu kaufenden Dingen, und erst dadurch, dass ein Ding in diese Auswahl gelangt, wird es zum potentiellen Gegenstand persönlichen Begehrens. So verhält es sich mit allen Dingen, Personen, sonstigen Gegebenheiten, denen ein Mensch begegnet. Damit äußerlich Wahrgenommenes in der Person zu einem Anreiz wird, der einen Konflikt auslöst zwischen den Handlungslinien ihrer personeigenen Freiheit und dem Gedanken einer Abweichung davon, braucht es eine Vorbedingung: Durch die Neigungen, Interessen, verborgenen Sehnsüchte der Person muss jenes Wahrgenommene überhaupt erst zum möglichen Anlass oder Objekt eines personalen Wunsches geworden sein. Worauf sich dieser Wunsch dann genau richtet, ist sekundär. Die entscheidende Voraussetzung für einen »Einfluss« von außen nach innen ist, dass etwas äußerlich Wahrgenommenes eine schon in der Person angelegte Handlungs- oder Lebenstendenz positiv oder negativ angeregt hat, so dass sich ein Wunsch dieser Person ausbilden konnte. Erst wenn in der Person etwas entstanden ist wie Begehren (oder Furcht, Abneigung, Fluchttendenz, was immer), kann sich überhaupt ein Konflikt entfalten, der ihre personeigene Freiheit bedroht, und an dem sich diese Freiheit bewährt oder eine Einbuße erleidet.6
Da personeigene Freiheit bei aller Unfestigkeit und trotz individueller Verschiedenheiten zu den Kerneigenschaften eines ausgebildeten menschlichen Selbst gehört, kann sie schwerlich allein im Befolgenkönnen fremder Handlungsanweisungen bestehen. Es sei denn, diese wurden von der Person in eigener Überlegung und Stellungnahme bekräftigt, wie Balaschow den Zarenbefehl auch im Prinzip ausführen »wollte«. Die jetzt gemeinte Freiheit als eine zentrale Eigenschaft von Wesen mit personaler Lebensform ist als eng verbunden zu denken mit den Instanzen bzw. Verfahren solcher Überlegung. Menschliche Personen zeichnen sich aus durch die grundsätzliche Fähigkeit, mit Bezug auf mögliche Handlungsweisen in eigener Stellungnahme ein Urteil über das Richtige im Gegensatz zum Falschen zu fällen. Traditionell fallen Vorstellungen und Argumente, die hier in Frage kommen, unter den Gedanken der Vernünftigkeit einer Person. Für viele Autoren der Aufklärungszeit begründeten ihre Ideale »Vernunft« und »Freiheit« ein auf Transzendenz, ja Zugehörigkeit zu einer höheren Welt ausgerichtetes Menschenbild. Heute kann die Verbindung unfester personeigener Freiheit mit einer diesseitig aufgefassten Vernünftigkeit menschlicher Personen helfen, eine nüchternere, stärker sachangemessene und wissenschaftlich besser vertretbare Auffassung vom Menschsein zu stützen. Diese Auffassung kann sich als definitiv irdisch wissen und der Natur allen Lebens auf dieser Erde verbunden.7
2. Der Wille ist kein innerlich auffindbarer Gegenstand
Kommen wir noch einmal auf Balaschow zurück. In Tolstois Darstellung erscheint er als verlässlicher Offizier. Er eignet sich als Beispiel für uns vor allem, weil sein Versagen für ihn unerwartet kommt, und weil der Erzähler über die möglichen Ursachen dieses Unerwarteten kaum mehr sagen kann, als dass es auf »ein verworrenes Gefühl« zurückging. Es sollte klar sein, dass jeder Person ein solches Versagen unterlaufen kann. Dies rechtfertigt eine weitreichende These: Niemand kann sich seiner personeigenen Freiheit zum tatsächlichen Ausführen aller Handlungen sicher sein, die er im Vorfeld einer beliebigen Situation für richtig oder verpflichtend hält und in diesem Vorfeld tun will. Es ist immer möglich, dass in der Situation selbst, unmittelbar vor der anvisierten Tat, unerwartet »verworrene Gefühle« oder Elemente ganz verschiedener Art eintreten und dazu beitragen, dass in Sekunden, ja Bruchteilen von Sekunden sich ein anderes Wollen bildet und dann ein anderes Tun erfolgt als zuvor entworfen. Über jene verschiedenen Elemente wird noch zu sprechen sein.
Die vorhin gegebene Deutung für das Versagen des Generals enthält eine Vorentscheidung, die ausdrücklich notiert werden soll. Es ist philosophische und auch juristische Konvention, dass wir zu menschlichem Handeln, wenn es den vollen Sinn des Wortes »Handeln« erfüllen soll, stets ein darauf gerichtetes Wollen oder einen darauf gerichteten »Willen« oder beides annehmen. Andernfalls würden wir von einer bloßen Körperbewegung ohne Absicht sprechen, vergleichbar etwa dem Lidschlagreflex, einem krankhaften Zucken, einer Fehlleistung im Freudschen Verständnis,