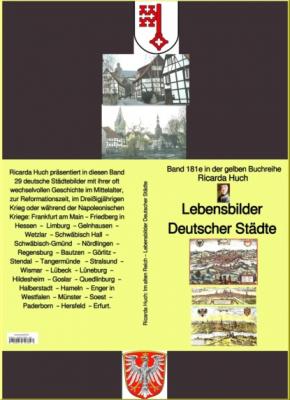ТОП просматриваемых книг сайта:
Ricarda Huch: Im alten Reich – Lebensbilder Deutscher Städte – Teil 2 - Band 181 in der gelben Buchreihe bei Ruszkowski. Ricarda Huch
Читать онлайн.Год выпуска 0
isbn 9783754181898
Автор произведения Ricarda Huch
Жанр Документальная литература
Серия gelbe Buchreihe
Издательство Bookwire
Unedel nicht nur, sondern auch unklug, also nicht mehr auf der Höhe ihrer früheren Politik, verhielten sich die Lübecker auch Gustav Wasa gegenüber, indem sie die Dankbarkeit, die er ihnen schuldete und auch nicht verleugnete, ungebührlich ausnutzten. Die Handelsprivilegien, die sie ihn zugunsten der Hanse unterzeichnen ließen, konnte er nicht aufrechterhalten, ohne sein eigenes Volk zu benachteiligen, und so zerfiel die Verbindung durch ein System der Erpressung, das wie ein fremdartiges Zeichen des Verfalls an der sonst so gemessenen Stadt berührt. Die alten Bundesgenossen, die Dithmarschen, preisgebend, verbündete man sich nun mit dem Erbfeind Dänemark. Der letzte Seekrieg, den Lübeck in den Jahren 1563-70 geführt hat, ging an der Seite Dänemarks gegen Schweden.
Welche Fehler aber auch begangen sein mögen, die hochherzige Kraft der Patrizier wie der Bürger offenbarte sich in diesem Krieg nicht weniger als früher. Die Bürger taten sich nach Straßen zusammen, um Geschütze gießen zu lassen. Auf einem standen die Verse: „Lübeck, du eerenrike stad – Dine börger der breden strat – Kobarg end klene borchstraten – Hebben di dit geten laten – Tho weren dines viendes overmod – Bi di seten wi god unde blot.“ Bedeutende Erfolge entsprachen der Kampfbereitschaft. Das lübische Admiralsschiff, der ENGEL, eroberte das schwedische Admiralsschiff MAGELOES, das danach verbrannte; die hundert Geretteten, unter denen der schwedische Admiral Jakob Bagge war, wurden gefangen nach Lübeck gebracht. Als durch ein Ungeschick beim Verladen des Pulvers auch der ENGEL verbrannte, wurde sogleich ein neues Admiralsschiff gebaut und MORIAN genannt. Nach einem heftigen, unentschiedenen Gefecht bei Gotland begruben die Dänen ihren im Gefecht durch eine Kugel getöteten Vize-Admiral in Wisby. Ein Sturm, der sich unterdessen erhob, zerstörte mehrere im Hafen liegende Schiffe; unter den lübischen war der MORIAN, der mit dem Anführer der Flotte, dem Bürgermeister Bartholomäus Tinnappel, unterging. In der Marienkirche zu Wisby, S. Maria Teutonicorum, der einzigen von den achtzehn mittelalterlichen Kirchen Wisbys, die noch heute erhalten und im Gebrauch ist, wurde er feierlich begraben. Den vorteilhaften Handelsvertrag, den der Frieden brachte, konnte Lübeck nicht behaupten; aber es hatte das rauschende Schlachtfeld, das seine Flotte oft zu Kampf und Sieg getragen, nicht ohne Opfer und ruhmvoll verlassen.
Es ist kein Wunder, wenn die Darstellung kriegerischer Entschlossenheit in der Lübecker Kunst unvergleichlichen Ausdruck gefunden hat. Während des ganzen Mittelalters waren der Erzengel Michael als Patron des Reichs und der heilige Georg als Patron der Ritterschaft häufiger Gegenstand der Kunst, und mancher würdigen Auffassung begegnen wir; nirgends jedoch ist der Akt des entscheidenden Schwertschlags so hinreißend dargestellt wie in Lübeck. Der heilige Michael von Benedikt Dreyer auf der Lettnerbrüstung der Marienkirche, der Sankt Jürgen von Henning von der Heide, jetzt ein Schatz des Annen-Museums, der Sankt Jürgen von Bernt Notke in der Hauptkirche von Stockholm, von dem Lübeck neuerdings bei Gelegenheit der Feier seines tausendjährigen Bestehens als Reichsstadt eine Nachbildung geschenkt erhielt, die in der Katharinenkirche ausgestellt wurde, alle diese Figuren entzücken durch die gesammelte Kraft der Bewegung, die trotz der Sicherheit des überirdischen Kämpfers mit äußerster Anstrengung vollzogen wird, die Phantastik des reptilischen Unholds, die Rüstung und den flatternden Mantel, der den Ritter wie die Essenz einer ungeheuren Schlacht umwogt. Diese Werke, wie auch der heilige Johannes in der Marienkirche, dessen seelenvolle Schönheit sich unvergesslich einprägt, sind aus Holz geschnitzt; es ist dasjenige Material, in dem sich die Eigentümlichkeit deutscher Künstlerschaft am überzeugendsten ausgeprägt hat. Die farbige Wärme, das Kantige und Zarte des Holzes stimmten besonders gut zum Ausdruck alles dessen, was den mittelalterlichen Menschen bis zum 16. Jahrhundert erfüllte, zu Inbrunst und Herzlichkeit sowie zu Zorn und Rache, zu den von Arbeit und Trauer durchfurchten Greisengesichtern, zu dem Geflatter und Geknister der Mäntel, Flügel und Schärpen, die die Altarwände zuweilen wie ein dorniges Dickicht erscheinen lassen.
In der Architektur ging Lübeck schon früh zum Steinbau über und errichtete die Giebelhäuser, die uns eine nicht nur mächtige, sondern vornehme und kultivierte Stadt vor Augen führen. Wenig alte Städte haben sich so gut in das Moderne einfügen lassen wie Lübeck, einesteils zum Vorteil der vollendeten Erscheinung, anderseits aber ist dadurch vom Neuen etwas von seiner Phantasielosigkeit und Schablone auf das Alte übertragen und macht die Stadt stellenweise kälter, als sie einst war. Die Traulichkeit des alten Lübeck weht vielleicht nirgends so mächtig wie im Heiligen-Geist-Spital, wo am Sonntagmorgen die alten Männer mit den verwitterten Seemannsgesichtern in schwarzen Kleidern, bedächtig flüsternd, zwischen den Säulen und Bogen sitzen, sanft gewiegt, ohne es zu wissen, von dem schönen Raum, dessen Wände in verblasster Malerei die Herrlichkeit der gekrönten Heiligen im Himmel erzählen.
Heiligen-Geist-Spital – Foto: Mylius
Wie die bildende Kunst gepflegt wurde, so war auch das Interesse für Literatur und Wissenschaft verbreitet. Die Fastnachtsspiele, die aufgeführt wurden, hatten allegorische und sagenhafte Stoffe zum Gegenstand, wie Paris von Troja, das goldene Vließ, Kriemhild und König Karl. Schon früh sorgten die Ratsherren dafür, dass Chroniken verfasst wurden. Eine solche begann im 13. Jahrhundert der Stadtschreiber Albert von Bardowik, der auch die wichtigsten Urkunden zusammenstellte. In der Reformationszeit waren es die protestantischen Geistlichen, die Chroniken in niederdeutscher Sprache verfassten. Ein Bürgermeister des 15. Jahrhunderts setzte in seinem Testament Stipendien für 6 Studenten aus, die in Leipzig, Erfurt, Rostock und Köln studieren würden. Besonders Erfurt war stark von Lübeckern besucht. In bemerkenswerter Weise wurde die Musik gepflegt, indem der Bürgermeister Heinrich Kastorp und seine Freunde im Jahr 1462 eine Sängerkapelle stifteten, die aus 4 Priestern und 8 Sängern bestand. Eine Kapelle der Marienkirche wurde den Sängern zu bestimmten Stunden eingeräumt; denn es versteht sich von selbst, dass die musikalischen Aufführungen im Zusammenhang mit der Kirche waren. Auch die Abendmusiken, die der berühmte Organist Dietrich Buxtehude im 17. Jahrhundert in Lübeck veranstaltete, fanden zuerst in der Marienkirche statt, bis sie zu einer Art von weltlichen Konzerten wurden.
Dieterich Buxtehude (* um 1637 wahrscheinlich in Helsingborg; † 9. Mai 1707 in Lübeck) war ein dänisch-deutscher Organist und Komponist des Barock. Sein Vorname ist auch in der Form Dietrich geläufig. Dieterich Buxtehude (dänisch „Diderik Buxtehude“) wurde um 1637 als Sohn des aus Oldesloe in Holstein stammenden Organisten Johann(es) Buxtehude (Hans Jenssen Buxtehude) geboren.
Lübeck ist niemals so verarmt und herabgekommen wie viele andere einst blühende Städte: es hatte zwei Talismane, das Meer und die Urkunden der Freiheit, die es im Tresor verwahrte. Nichtsdestoweniger litt es auch unter dem Allgemeinen Niedergange. Viele Hansestädte kamen unter fürstliche Herrschaft, ohne dass die freigebliebenen es hindern konnten. Als der Kurfürst von Brandenburg Berlin unterwarf, beklagte der Lübecker Chronist, dass die Hansestadt eigen geworden war, „dor se vor vryg ware unde wol mochte hebben vryg gebleven“.
Abgesehen von dem Auseinanderfallen der Hanse schadeten den Seestädten die veränderten Handelsbeziehungen, die die Entdeckung Amerikas herbeiführte. Die Länder, deren Markt die deutsche Hanse beherrscht hatte, erstarkten zu unternehmenden Handelsstaaten, besonders Holland und England, die ihre Lage darauf hinwies. Hamburg, für die neuen Verhältnisse günstiger gelegen als Lübeck, entfaltete sich selbständig, von der Hanse losgelöst. Überall machte sich das Schwinden des Gemeingeistes fühlbar.
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ereignete es sich, dass Handwerker und Brauer über gewisse patrizische Gutsherren Klage führten, die auf ihren Gütern durch ihre Gutsangehörigen brauen und weben ließen, und zwar nicht nur zu eigenem Bedarf, sondern sie hielten Schenken und vertrieben unter der Hand Ware nach der Stadt, was gegen das Zunftrecht war. Da die Behörden die berechtigten Klagen der Handwerker unbeachtet ließen, zogen sie erbittert aufs Land und zerstörten die Gerätschaften, die zur Herstellung der sie beeinträchtigenden Dinge dienten. Die geschädigten Gutsherren, darunter der Bürgermeister Gotthard v. Höveln, dachten niedrig genug, sich dem König von Dänemark als Untertanen anzubieten, womit sie sich zugleich Steuerfreiheit verdienten; denn der König von Dänemark bediente sich