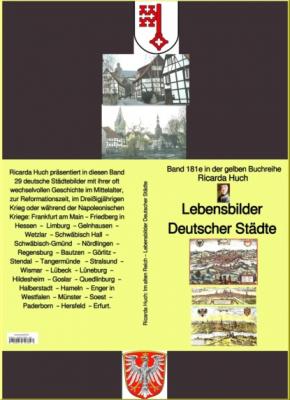ТОП просматриваемых книг сайта:
Ricarda Huch: Im alten Reich – Lebensbilder Deutscher Städte – Teil 2 - Band 181 in der gelben Buchreihe bei Ruszkowski. Ricarda Huch
Читать онлайн.Год выпуска 0
isbn 9783754181898
Автор произведения Ricarda Huch
Жанр Документальная литература
Серия gelbe Buchreihe
Издательство Bookwire
Kaiser Friedrich II.
„Se sochten wisen rat“, heißt es in der Chronik, „wo se weder quemen an den Kaiser, eren rechten heren.“ Die Boten kamen zurück mit zwei Urkunden, von denen jede doppelt ausgefertigt war, und zwar so, dass jede einmal mit einem Wachssiegel, einmal mir einer goldenen Siegelkapsel, einer bulla aurea, versehen war; die erste Urkunde bestätigt das von Friedrich I. verliehene Privileg, die zweite erteilte das unschätzbar hohe Gut der Reichsfreiheit.
Friedrich I.
Die maßgebende Stelle lautet: Concedimus firmiter statuentes at predicta civitas Lubicensis libera semper sit, videlicet specialis civitas et locus Imperii et ad dominium Imperiale specialiter pertinens, nullo unquam tempore ab ipso speciali dominio separanda.
Der Freiheitsbrief des Hohenstaufenhauses wurde als Grundlage der städtischen Selbständigkeit im Tresor der Marienkirche verwahrt. Wie mächtig oder wie schwach das Reich gerade sein mochte, die Reichsfreiheit erwies sich immer als schirmender Wall. Fortan nannte sich Lübeck die kaiserlich freie und des römischen Reichs Stadt oder die freie und Hansestadt Lübeck und trug diesen Titel weniger wie einen Orden als wie einen Zauberring, der die guten Geister in den Dienst des Trägers zwingt. Kaiserbilder und Kaiseradler prägten die Münzen. Ergreifend offenbart sich den Menschen unserer Zeit die mittelalterliche Idee des Kaisertums in jener ehernen Kaiserfigur, welche an der einen Wange des Beischlags vor dem Rathaus dargestellt ist. Schwermütig, gütig, das große Haupt erfüllt von undurchdringlichen, die Welt umkreisenden Gedanken, sitzt der Alte da, man weiß nicht, ob Kaiser oder Gottvater, wie ja auch nach der Meinung des Mittelalters, die göttliche Gerechtigkeit und Gnade durch den Kaiser der Christenheit sich mitteilen sollte. Der wilde Mann auf der gegenüberliegenden Wange verdeutlicht die rohe Kraft des Elements gegenüber der göttlich geordneten Welt.
Wenn die Stadt sich gern mit ihrer Würde schmückte und das ihr damit verliehene Recht wahrte, nahm sie es ebenso ernst mit den Leistungen, zu denen sie sie verpflichtete. Solange das Reich bestand, stellte Lübeck als Reichsstand entweder die jeweils vorgeschriebene Zahl von Kämpfern oder die entsprechende Geldlieferung; es bezahlte die jährliche Reichssteuer durch alle Jahrhunderte entweder in die kaiserliche Kasse oder an diejenigen Fürsten, denen geldbedürftige Kaiser sie verpfändet hatten, bis zum Jahr 1806, wo das Reich unterging. Die Tatsache, dass es dem Reich angehörte, nutzte Lübeck nicht nur aus, sondern es diente ihr auch durch repräsentatives, zuweilen Opfer erforderndes Handeln.
Seit den Tagen Barbarossas gingen zweihundert Jahre vorüber, bis wieder ein Kaiser in Lübeck einzog: es war Karl IV., der sich in Brandenburg eine Hausmacht gründen wollte und deshalb für die nordischen Länder Interessen hatte, zu denen er auch durch seine Gemahlin Elisabeth von Pommern in Beziehung stand.
Karl IV.
So wie der Kaiser das Haupt der Hanse auszuzeichnen dachte, beschloss auch die Stadt, ihren Herrn mit allem Gepränge zu empfangen, das sie, wenn es darauf ankam, zu entfalten wusste. Zwei wichtige Privilegien, die Karl in Berlin ausstellte, bereiteten ihm den Weg: sie verliehen dem Rat die volle Gerichtsbarkeit des Landfriedens, so dass er als Stellvertreter der Reichsgewalt etwaige Friedensbrecher zu Land und zur See auch auf fürstliches Gebiet verfolgen konnte. Am 20. Oktober des Jahres 1375 fand der Einzug statt. Nachdem Kaiser und Kaiserin in der Gertrudkapelle vor dem Burgtor ihre kaiserlichen Gewänder angelegt hatten, bewegte sich die Prozession durch die Stadt zum Dom. Dem Herzog von Braunschweig-Lüneburg, der das Reichsschwert vorantrug, folgte unter einem Baldachin der Kaiser auf einem Pferd, das von zwei Bürgermeistern geführt wurde. Das Pferd der Kaiserin, die neben dem Erzbischof von Köln ebenfalls unter einem Baldachin ritt, führten zwei Ratsherren. Der Rat unterstützte zwar die Politik des Kaisers nicht, weil sie ihm nicht passte, ließ aber von dem denkwürdigen Einzug ein Gemälde herstellen und auf das Rathaus bringen, das im 17. Jahrhundert noch vorhanden war. In dem Haus des Gerhard Darsow, wo der Kaiser abstieg, befand sich in neuerer Zeit ein Gasthaus Zum deutschen Kaiser.
Die Reichsunmittelbarkeit, die Lübeck über die anderen Seestädte erhob, trug dazu bei, ihm eine führende Stellung in der Hanse zu ermöglichen; mehr noch begründete diese der Charakter, der es auszeichnete.
Lübeck zur Hansezeit
Es ist erstaunlich, wie eine bestimmte Art von Diplomatie und Politik sich in Lübeck ausbildete und bei allem Unterschied der Personen bis ins 16. Jahrhundert dieselbe blieb. Was die handeltreibenden Städte der nordwestlichen und nordöstlichen Küste bewog, die Leitung ihrer auswärtigen Angelegenheiten Lübeck zu übertragen, vielmehr sie anzunehmen, war vor allem die Einsicht, dass keine andere so dazu befähigt war. Den Willen zu herrschen hätten wohl auch andere gehabt, nicht aber die Fähigkeit, anzuführen, die Geschäfte besonnen zu erledigen, die Verantwortung für eine große Interessengruppe auf sich zu nehmen. Die Menschen beugen sich in der Regel einer überlegenen Arbeitskraft und Verantwortungskraft, die entlastet, umso lieber, wenn sie nicht mit gebieterischer Gebärde auftritt.
Handelsrouten der Hanse
Die Lübecker hatten zuviel kluge Selbstbeherrschung und legten zuviel Wert auf das Wesen der Dinge, um den Schein der Herrschaft zu beanspruchen. Einmal in ihren Anfängen fand ein merkwürdiges, alleinstehendes Ereignis statt, als Lübeck Stralsund überfiel und verheerte, angeblich weil es die Dänen unterstützte, wahrscheinlich aus Eifersucht auf die aufblühende Nebenbuhlerin. Ein derartig ungeregelter Ausbruch kam nicht wieder vor; die Lübecker begriffen den Vorteil der Vereinigung gleichartiger Kräfte und Interessen zu gemeinsamem Handeln. Sie verschmähten es, vom Ausland nur sie begünstigende Privilegien zu erhalten, setzten vielmehr durch, dass alle berücksichtigt wurden. Weil sich alle gut bei Lübecks tatkräftiger und kluger Leitung standen, darum ließen sie sie zu, stillschweigende Huldigung überlegener Tauglichkeit. Wenn die Hanse auch nur durch die Mitwirkung vieler sich bilden und erhalten konnte, so hat doch Lübeck, das anerkannte Haupt, ihr das Antlitz gegeben. Wenn wir an die Hanse denken, sehen wir wesentlich Lübecks Gesicht. Das hatte auch seinen greifbaren Grund darin, dass viele Hansestädte lübisches Recht hatten, das Recht also, das sich in Lübeck entwickelt hatte und dort aufgezeichnet worden war. Lübeck selbst übernahm das Recht der westfälischen Stadt Soest. Von