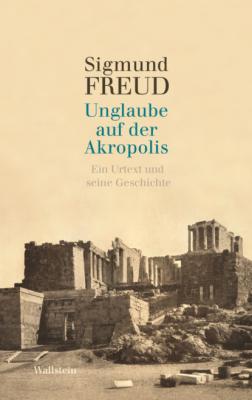ТОП просматриваемых книг сайта:
Unglaube auf der Akropolis. Sigmund Freud
Читать онлайн.Название Unglaube auf der Akropolis
Год выпуска 0
isbn 9783835345829
Автор произведения Sigmund Freud
Жанр Языкознание
Издательство Bookwire
Damit wäre, meine ich, unser Benehmen in Triest erklärt. Wir konnten nicht glauben, daß uns die Freude bestimmt sein sollte, Athen zu sehen. Daß das Stück Realität, das wir ablehnen wollten, zunächst nur eine Möglichkeit war, bestimmte die Eigentümlichkeiten unserer damaligen Reaktion. Als wir dann auf der Akropolis standen, war die Möglichkeit zur Wirklichkeit geworden, und derselbe Unglaube fand nun einen veränderten, aber weit deutlicheren Ausdruck. Dieser hätte ohne Entstellung lauten sollen: Ich hätte wirklich nicht geglaubt, daß es mir je gegönnt sein würde, Athen mit meinen eigenen Augen zu sehen, wie es doch jetzt unzweifelhaft der Fall ist! Wenn ich mich erinnere, welche glühende Sehnsucht, zu reisen und die Welt zu sehen, mich in der Gymnasialzeit und später beherrscht hatte und wie spät sie sich in Erfüllung umzusetzen begann, verwundere ich mich dieser Nachwirkung auf der Akropolis nicht; ich war damals achtundvierzig Jahre alt. Ich habe meinen jüngeren Bruder nicht befragt, ob er ähnliches wie ich verspürt. Eine gewisse Scheu lag über dem ganzen Erlebnis, sie hatte schon in Triest unseren Gedankenaustausch behindert.
Wenn ich aber den Sinn meines Einfalls auf der Akropolis richtig erraten habe, er drücke meine freudige Verwunderung darüber aus, daß ich mich jetzt an diesem Ort befinde, so erhebt sich die weitere Frage, warum dieser Sinn im Einfall eine so entstellte und entstellende Einkleidung erfahren hat.
Der wesentliche Inhalt des Gedankens ist auch in der Entstellung erhalten geblieben, es ist ein Unglaube. »Nach dem Zeugnis meiner Sinne stehe ich jetzt auf der Akropolis, allein ich kann es nicht glauben.« Dieser Unglaube, dieser Zweifel an einem Stück der Realität, wird aber in der Äußerung in zweifacher Weise verschoben, erstens in die Vergangenheit gerückt und zweitens von meiner Beziehung zur Akropolis weg auf die Existenz der Akropolis selbst verlegt. So kommt etwas zustande, was der Behauptung gleichkommt, ich hätte früher einmal an der realen Existenz der Akropolis gezweifelt, was meine Erinnerung aber als unrichtig, ja als unmöglich ablehnt.
Die beiden Entstellungen bedeuten zwei voneinander unabhängige Probleme. Man kann versuchen, tiefer in den Umsetzungsprozeß einzudringen. Ohne näher anzugeben, wie ich dazu komme, will ich davon ausgehen, das Ursprüngliche müsse eine Empfindung gewesen sein, daß an der damaligen Situation etwas Unglaubwürdiges und Unwirkliches zu verspüren sei. Die Situation umfaßt meine Person, die Akropolis und meine Wahrnehmung derselben. Ich weiß diesen Zweifel nicht unterzubringen, ich kann ja meine Sinneseindrücke von der Akropolis nicht in Zweifel ziehen. Ich erinnere mich aber, daß ich in der Vergangenheit an etwas gezweifelt, was mit eben dieser Örtlichkeit zu tun hatte, und finde so die Auskunft, den Zweifel in die Vergangenheit zu versetzen. Aber dabei ändert der Zweifel seinen Inhalt. Ich erinnere mich nicht einfach daran, daß ich in frühen Jahren daran gezweifelt, ob ich je die Akropolis selbst sehen werde, sondern ich behaupte, daß ich damals überhaupt nicht an die Realität der Akropolis geglaubt habe. Grade aus diesem Ergebnis der Entstellung ziehe ich den Schluß, daß die gegenwärtige Situation auf der Akropolis ein Element von Zweifel an der Realität enthalten hat. Es ist mir bisher gewiß nicht gelungen, den Hergang klarzumachen, darum will ich kurz abschließend sagen, die ganze anscheinend verworrene und schwer darstellbare psychische Situation löst sich glatt durch die Annahme, daß ich damals auf der Akropolis einen Moment lang das Gefühl hatte – oder hätte haben können: was ich da sehe, ist nicht wirklich. Man nennt das ein »Entfremdungsgefühl«. Ich machte einen Versuch, mich dessen zu erwehren, und es gelang mir auf Kosten einer falschen Aussage über die Vergangenheit.
Diese Entfremdungen sind sehr merkwürdige, noch wenig verstandene Phänomene. Man beschreibt sie als »Empfindungen«, aber es sind offenbar komplizierte Vorgänge, an bestimmte Inhalte geknüpft und mit Entscheidungen über diese Inhalte verbunden. Bei gewissen psychischen Erkrankungen sehr häufig, sind sie doch auch dem normalen Menschen nicht unbekannt, etwa wie die gelegentlichen Halluzinationen der Gesunden. Aber sie sind doch gewiß Fehlleistungen, von abnormem Aufbau wie die Träume, die ungeachtet ihres regelmäßigen Vorkommens beim Gesunden uns als Vorbilder seelischer Störung gelten. Man beobachtet sie in zweierlei Formen; entweder erscheint uns ein Stück der Realität als fremd oder ein Stück des eigenen Ichs. In letzterem Fall spricht man von »Depersonalisation«; Entfremdungen und Depersonalisationen gehören innig zusammen. Es gibt andere Phänomene, in denen wir gleichsam die positiven Gegenstücke zu ihnen erkennen mögen, die sog. »Fausse reconnaissance«, das »Déjà vu«, »Déjà raconté«, Täuschungen, in denen wir etwas als zu unserem Ich gehörig annehmen wollen, wie wir bei den Entfremdungen etwas von uns auszuschließen bemüht sind. Ein naiv-mystischer, unpsychologischer Erklärungsversuch will die Phänomene des Déjà vu als Beweise für frühere Existenzen unseres seelischen Ichs verwerten. Von der Depersonalisation führt der Weg zu der höchst merkwürdigen »Double Conscience«, die man richtiger »Persönlichkeitsspaltung« benennt. Das ist alles noch so dunkel, so wenig wissenschaftlich bezwungen, daß ich mir verbieten muß, es vor Ihnen weiter zu erörtern.
Es genügt meiner Absicht, wenn ich auf zwei allgemeine Charaktere der Entfremdungsphänomene zurückkomme. Der erste ist, sie dienen alle der Abwehr, wollen etwas vom Ich fernhalten, verleugnen. Nun kommen von zwei Seiten her neue Elemente an das Ich heran, die zur Abwehr auffordern können, aus der realen Außenwelt und aus der Innenwelt der im Ich auftauchenden Gedanken und Regungen. Vielleicht deckt diese Alternative die Unterscheidung zwischen den eigentlichen Entfremdungen und den Depersonalisationen. Es gibt eine außerordentliche Fülle von Methoden, Mechanismen sagen wir, deren sich unser Ich bei der Erledigung seiner Abwehraufgaben bedient. In meiner nächsten Nähe erwächst jetzt eine Arbeit, die sich mit dem Studium dieser Abwehrmethoden beschäftigt; meine Tochter, die Kinderanalytikerin, schreibt eben ein Buch darüber. Von der primitivsten und gründlichsten dieser Methoden, von der »Verdrängung«, hat unsere Vertiefung in die Psychopathologie überhaupt ihren Ausgang genommen. Zwischen der Verdrängung und der normal zu nennenden Abwehr des Peinlich-Unerträglichen durch Anerkennung, Überlegung, Urteil und zweckmäßiges Handeln liegt eine große Reihe von Verhaltungsweisen des Ichs von mehr oder weniger deutlich pathologischem Charakter. Darf ich bei einem Grenzfall einer solchen Abwehr verweilen? Sie kennen das berühmte Klagelied der spanischen Mauren »Ay de mi Alhama«, das erzählt, wie der König Boabdil die Nachricht vom Fall seiner Stadt Alhama aufnimmt. Er ahnt, daß dieser Verlust das Ende seiner Herrschaft bedeutet. Aber er will es nicht »wahr haben«, er beschließt, die Nachricht als »non arrivé« zu behandeln. Die Strophe lautet:
Cartas le fueron venidas
que Alhama era ganada:
las cartas echo en el fuego
y al mensajero matara.1)
Man errät leicht, daß an diesem Benehmen des Königs das Bedürfnis mitbeteiligt ist,