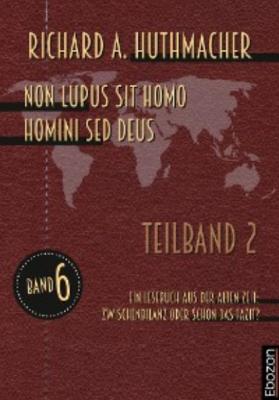ТОП просматриваемых книг сайта:
Non lupus sit homo homini sed deus (Teilband 2). Richard A. Huthmacher
Читать онлайн.Название Non lupus sit homo homini sed deus (Teilband 2)
Год выпуска 0
isbn 9783959637855
Автор произведения Richard A. Huthmacher
Жанр Языкознание
Издательство Автор
Als Beckmann sich, vom Fluss ausgespien, am Strand der Elbe wiederfindet, gesellt sich (in der kaleidoskopartigen Aneinanderreihungen traumhafter Szenen, aus denen Borcherts Stück besteht) der „Andere“, der Ja-Sager, zu ihm, begleitet ihn, belehrt ihn. Ermutigt ihn, an das Gute im Menschen zu glauben. Doch dazu ist Beckmann nicht mehr imstande und erklärt dem „Anderen“, warum: Weil er nur noch Beckmann heißt. Ohne Vornamen, einfach Beckmann.
„Seit gestern heiße ich nur noch Beckmann. Einfach Beckmann. So wie der Tisch Tisch heißt … Ich war nämlich drei Jahre lang weg. In Rußland. Und gestern kam ich wieder nach Hause. Das war das Unglück. Drei Jahre sind viel, weißt du. Beckmann – sagte meine Frau zu mir. Einfach Beckmann. Und dabei war man drei Jahre weg. Beckmann sagte sie, wie man zu einem Tisch Tisch sagt. Möbelstück Beckmann. Stell es weg. Das Möbelstück Beckmann.“
Eine Frau kommt hinzu, hat Mitleid mit Beckmann, nimmt ihn bei sich auf. Doch unvermittelt taucht ihr Mann auf, ebenfalls Kriegsheimkehrer, ein Einbeiniger, den seinerzeit Beckmanns Befehl, die Stellung zu halten, das Bein gekostet hat; vorwurfsvoll, verzweifelt, weidwund schreit der Kriegskrüppel Beckmanns Namen, verlangt sein Bein und seine Frau zurück.
Beckmann flüchtet, zu seinem früheren Oberst – um diesem seinerseits die Verantwortung für all die unsinnigen Befehle, für all die Schuld, die ihn keine Nacht mehr schlafen lässt, zurückzugeben. Für den Oberst indes ist Verantwortung eine leere Floskel; er rät dem heruntergekommenen Beckmann, erst einmal wieder Mensch zu werden. Für ihn, den Oberst, reduziert sich Menschsein indes auf Äußerlichkeiten; Beckmanns nächtliche Traumgespinste, in denen ein General mit Armprothesen auf einem Xylophon aus Menschenknochen die „Alten Kameraden“ spielt, haben keinen Platz in seiner selbstgewissen und seinsvergessenen Welt.
Es folgen weitere Szenen, in denen Beckmann unter anderem erfährt, dass seine Eltern sich „entnazifizierten“ haben, indem sie den Kopf in die Backröhre steckten. Schade sei dies um das verschwendete Gas, so eine Nachbarin (eine ungleich größere Verschwendung von Gas wenige Jahre zuvor assoziierend).
Schließlich wird Beckmann, in einer traumartigen Sequenz, nochmals mit allen Figuren des Stücks konfrontiert. Doch weder der „Andere“ noch Gott, den er fragt, wann er denn ein „lieber“ Gott gewesen sei, auch nicht der Tod, der ihm verspricht, seine Tür stehe jederzeit offen, keiner von allen ist imstande, seine aus Angst, Not und Verzweiflung geborenen Fragen zu beantworten.
Weshalb Beckmann am Ende aufschreit: „Gibt denn keiner Antwort? Gibt keiner Antwort??? Gibt denn keiner, keiner Antwort???“
„Dieses Stück ist in der Glut einer irdischen Vorhölle gebrannt worden, es ist mehr als eine literarische Angelegenheit, in ihm verdichten sich die Stimmen von Millionen, von Toten und Lebenden, von vorgestern, gestern, heute und morgen, zur Anklage und Mahnung. Das Leid dieser Millionen wird Schrei. Das ist Borcherts Stück: Schrei! Nur so kann es begriffen und gewertet werden“ …
Die Rezeption von Borcherts Stück „Draußen vor der Tür“, das zunächst (im Februar ´47) als Hörspiel ausgestrahlt und dann (im November ´47) an den Hamburger Kammerspielen (unter der Intendanz von Ida Ehre und in der Regie von Wolfgang Liebeneiner) als Theaterstück uraufgeführt wurde, war höchst unterschiedlich und reichte von diffamierender Ablehnung bis zu begeisterter Zustimmung …
Beckmann selbst starb einen Tag vor der Uraufführung des Theaterstücks, physisch und psychisch zerrüttet durch den Krieg und zwei Inhaftierungen wegen sogenannter Wehrkraftzersetzung …
Er war gerade einmal 26 Jahre alt.
(Richard Alois Huthmacher: Offensichtliches, Allzuoffensichtliches. Ein Briefroman. Teil 1, 2014: Wolfgang Borchert, „Draußen vor der Tür“ und die Kriegsheimkehrer.)
REGIEANWEISUNG:
Richard Wagner: Walkürenritt
(https://www.youtube.com/watch?v=23ns97Y3xBI)
Abrupter Abbruch
Während des Wallkürenritts schreit eine junge (Soldaten-)Stimme: Mamaa.
Sie schreit, wieder und wieder und so laut, dass bisweilen gar der Wallkürenritt übertönt wird.
Dann verstummt das Schreien. Deutlich ist – seit Beginn und während des gesamten 2. Aktes – Kriegsgetöse zu hören, mal lauter, mal weniger laut. Schüsse peitschen, Granaten heulen, Bomben explodieren.
REINHARD:
Wie seinerzeit in Kindertagen
Im Reich der Phantasie, weit weg von späteren Gewittertagen, als meine Kinderträum erschlagen, als selten noch die Sonne schien und längst verwelkt die Blütenträume, die einst der Kindheit und der Jugend Bäume als bunte Pracht getragen, in diesem Reich der Kinderphantasie möchte ich noch einmal leben, in diesem kindlich Leben eben, in dem die Stunde wird zum Tag, der Tag gar wird zur Ewigkeit, in dieser, ach, so eignen Welt, in der das Kind, ganz unverzagt und von des Daseins Last noch nicht geplagt, lebt still vergnügt und ohne Sorgen und ohne gestern, heute, morgen ganz einfach in den Tag hinein – mein Gott, wie könnt das herrlich sein!
REGIEANWEISUNG:
Der junge Soldat schreit wieder, immer nur das eine Wort: Maama.
Langsam erstickt seine Stimme.
Zarah Leander: Davon geht die Welt nicht unter
(https://www.youtube.com/watch?v=p8D126NPTrU)
Wenn mal mein Herz unglücklich liebt,
Ist es vor Kummer unsagbar betrübt.
Dann denk ich immer:
Alles ist aus.
Ich bin so allein.
Wo ist ein Mensch, der mich versteht,
So hab ich manchmal voll Sehnsucht gefleht.
Tja, aber dann gewöhnt ich mich dran,
Und ich sah es ein:
Davon geht die Welt nicht unter,
Sieht man sie manchmal auch grau.
Einmal wird sie wieder bunter,
Einmal wird sie wieder himmelblau.
Geht mal drüber und mal drunter,
Wenn uns der Schädel auch graut:
Davon geht die Welt nicht unter,
Sie wird ja noch gebraucht.
Davon geht die Welt nicht unter,
Sie wird ja noch gebraucht.
Davon geht die Welt nicht unter,
Sieht man sie manchmal auch grau.
Einmal wird sie wieder bunter,
Einmal wird sie wieder himmelblau.
Geht mal drüber und mal drunter,
Wenn uns der Schädel auch graut:
Davon geht die Welt nicht unter,
Sie wird ja noch gebraucht.
Davon geht die Welt nicht unter,
Sie wird ja noch gebraucht.
MARIA:
Weh dem, der nicht in Kinderzeit geborgen
Weh dem, der nicht in Kinderzeit geborgen, wie könnt ertragen all die Sorgen, des weitren Lebens Tage und deren Not und Schmach und all des Lebens Ungemach der, welcher schon als Kind, mit bangem Zagen, des Lebens Elend musste tragen und der bereits in frühen Kindertagen mit seinem Schicksal musste ringen, wie also