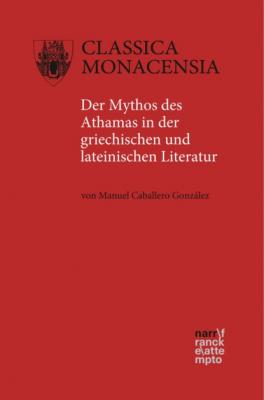ТОП просматриваемых книг сайта:
Der Mythos des Athamas in der griechischen und lateinischen Literatur. Manuel Caballero González
Читать онлайн.Название Der Mythos des Athamas in der griechischen und lateinischen Literatur
Год выпуска 0
isbn 9783823300045
Автор произведения Manuel Caballero González
Жанр Документальная литература
Серия Classica Monacensia
Издательство Bookwire
Das arglistige, heimliche oder durch andere Figuren vermittelte Agieren häuft sich im Text. Athamas wird von den FurienFurien und durch ein Trugbild gehetzt, aber es ist Juno, die dahinter steckt – Saturnia taucht in einer anderen (deswegen falschen) Gestalt auf – Juno sagt, dass Ino falsch ist und sich als Freundin vorstellt, obwohl sie keine Freundin der Mänaden ist – Carmentis sagt voraus, aber dies scheint nur so: Der Gott spricht aus ihr – Man sieht Ino und Melikertes, aber sie sind die Gottheiten Leukothea-Mutter Matuta und Palaimon-PortunusPortunus – Athamas verliebt sich heimlich in eine Dienerin – Die SklavinSklavin enthüllt ihm Inos IntrigeIntrige – Man muss für die Kinder der anderen beten91.
Der Text ist voll von intertextuellen Hinweisen. Zunächst wendet sich Ovid an die guten Mütter und dann beginnt die echte Erzählung; aber sofort berichtet der Dichter eine ganz andere Geschichte (ferunt, Vers 479) und geht auf die Zeit der Könige zurück, eine Zeit, die der mythologischen Zeit der Helden und Götter sehr nah ist. Der Dichter kommt noch einmal zur Gegenwart zurück und ruft Bacchus an: Dies ist nicht Ovids Geschichte, sondern Bacchus‘, einer der wichtigsten Figuren dieses Berichts, obwohl der Leser nicht Bacchus’ Worte liest, sondern die Worte Ovids. Besser gesagt: Dies sind die Worte des von Bacchus geführten Dichters, weswegen der Gott noch ein zweites Mal angerufen wird. Die Erzählung wird fortgesetzt, Ovid spricht mit jeder Figur, die unter dem Bösen leidet, er redet nicht mit denen, die dieses Übel veranlassen. So wendet sich Ovid weder an JunoJuno noch an Athamas, der am Ende des Gedichts, in Vers 555, für improbus gehalten wird, noch an Ino in dieser Abteilung, denn auch sie wurde von den FurienFurien gehetzt, wie sie nachher zugibt, sondern an Learchos92 und Melikertes. Ovid berichtet die I-L-M-Version, von Athamas’ Wahnsinn und Learchos’ Tod bis zu Inos Sprung mit Melikertes ins Meer.
Ovid fährt mit der Geschichte fort, aber der Ton ist ab Inos Sprung ganz anders. Zunächst wird die unbeschwerte Reise von Ino und Melikertes dank Panope und ihrer Schwestern dargestellt; da beginnen die Worte, die bis jetzt nicht ausgesprochen worden sind, aufzutauchen; erst kommen sie indirekt vor, dann werden sie wortwörtlich berichtet. Die Gefahr ist jedoch nicht gebannt, denn die bösartige Macht der ersten Abteilung ist noch da, aber heimlich, weil sich alles geändert hat: Juno, als Saturnia betrachtet, das heißt, als Tochter von Saturn, der seine eigenen Kinder verzehrt, stachelt (der Name des Hains wies den Leser auf die Gefahr hin) die Mänaden an, Inos Sohn zu zerreißen. Nun spricht nicht Ovid, sondern Juno, und sie wendet sich nicht an den Leser, sondern an die Mänaden; Ovid versucht die Situation zu kontrollieren und ergreift das Wort, aber die Aktion ist stärker als er, seine Stimme geht im Geschrei der Mänaden unter. Dann ruft Ino die Götter und die Männer des Landes, und zwar diejenigen von RomRom, die die guten Mütter begleiten und an die der Dichter sich wendet. Inos Schreien wird gehört und der Held dieser Zeit, Herkules – der nicht Römer ist – tritt in Erscheinung; Ovid kann seine Erzählung fortsetzen. Herkules kommt herbei, die Mänaden flüchten und es herrscht wieder Ruhe. Dann fragt Herkules Ino, aber es ist Ovid, der antwortet, und nicht sie. Genauso wie Juno ihr Gesicht verbirgt, verbirgt Ino ihre Vergangenheit. Der Dichter ruft Athamas’ Ehefrau, wobei der Leser zu einer anderen Dimension der Geschichte geleitet wird: Ovid erzählt nicht den guten Müttern oder dem Leser Inos Geschichte, sondern ihr selber.
Ovid redet durch den Mund eines anderen: ferunt; rumor und nun diceris, traditur; der Sprecher bleibt unbekannt. Ovid ist nur ein Übertragungsweg, Leser oder Zuhörer einer Erzählung, die ihn überfordert. Diese unpersönlichen Subjekte, nämlich unbekannte Menschen einer mythologischen Zeit, lassen Ovid und seine Zeitgenossen vorbeiziehen: ‚Was damals passiert ist, erfahrt ihr, Römerinnen, auch heutzutage‘. Ovid spielt mit der Zeit. Rigoros bringt er die Zeitachse in Unordnung (535): ‘nunc’, ait‘o uates, uenientia fata resigna’.
Zwei Verse früher wurden auch mit einem nunc begonnen, aber dieses bezog sich auf seinen echten Inhalt, nämlich Ovids Zeit; am Anfang des Verses 535 ist das ‚jetzt‘ nicht real, sondern mythologisch, wie man dank des danebenstehenden ait bemerkt. Dies ist das ‚nun‘ der Weissagerin und nicht das der guten Mütter, es ist die Gegenwart der Vergangenheit. Aber diese Vergangenheit, die Gegenwart geworden ist, bleibt nicht bei sich selbst, sondern sie richtet sich wie von einer Schleuder geworfen an die Zukunft, bzw. an die Vergangenheit und die Gegenwart der guten Mütter und der Männer des Landes in der Zeit von Ovid.
Der Dichter führt noch einmal die Erzählung weiter und schildert die Umstände. Aber sofort ergreift wieder die Prophetin das Wort und beginnt laeta (541) zu singen und von der Zukunft zu sprechen, die Ovids Leser gegenwärtig ist. Wichtig ist, zu beachten, dass eigentlich nicht Carmentis weissagt, sondern der Gott, von dem sie besessen ist und dem sie nur die Stimme leiht. In diesem Moment geschieht die Enthüllung der Namen, die den griechischen Ursprung preisgibt und die lateinische Gegenwart von Ino und Melikertes verrät. Ovid endet mit der Vergangenheit, nachdem die Gestalten ihren Namen geändert haben, und er führt sie bis zum Leser, bis zur Gegenwart (550): … hic deus, illa dea est.
In diesem Augenblick bricht die Rede ab und eine Antwort taucht auf, zu der nie eine Frage gestellt worden war: Ovid führt die guten Mütter in die Erzählung ein und stellt den Text als einen Dialog dar, von dem nur die Worte einer Gesprächspartnerin festgehalten sind; so findet die ‚Unterhaltung‘ mit Ino statt. In der Tat antwortet Ovid den guten Müttern, indem er Ino erzählt, was bei ihr eigentlich geschah; denn die Dienerin, die zur Geliebten Athamas’ wurde, war Inos und nicht Athamas’ SklavinSklavin. Der Aiolide ist untreu und heuchlerisch, weil er diese Verliebheit zuließ; er handelte nicht offensichtlich, sondern heimlich, wie Saturnia in Semeles Hain. Dann antwortet Ovid, indem er immer noch zu Ino, und zu den guten Müttern spricht, tritt in Athamas’ Haus ein und hört, wie die Dienerin Athamas die Arglist hinsichtlich des gedörrten Samens enthüllt. Die Stimmen erheben sich überall: Die Dienerin verrät Athamas Inos IntrigeIntrige; Ino leugnet es, aber der Ruf, die Sage, nimmt es an. All dies bringt Ovid zur Sprache, der auf eine Frage antwortet, und die guten Mütter sind die Zuhörer der Antwort. Einfach genial!
Darüber hinaus kann man eine gewisse Ringkomposition des Chors in diesem letzten Teil feststellen: Mütter – Ovid – Ino – Dienerin / Athamas / Ino / Ruf – Ino – Ovid – Mütter. Es scheint, dass der Dichter die Frage von den guten Müttern gestellt bekommt, aber er antwortet nicht ihnen, sondern Ino (558): hoc est cur odio sit tibi serua manus. Ovid nimmt das Wort wieder auf und mahnt die frommen Mütter: Sie (hier ergreifen sie noch einmal das Wort) müssen die Kinder anderen Leuten übergeben, denn utilior Baccho quam fuit illa suis (562). Und der Text schließt mit Bacchus, der als erster in der Textstelle angerufen wurde.
Interessant ist es, an dieser Stelle die in den Metamorphosen und den Fasten berichtete Erzählung der I-L-M-Version schematisch zu vergleichen, worauf Bömer in seinem Kommentar hinweist93:
| Metamorphosen | Fasten | ||
| IV | 416 Überleitung: Bacchus in ThebenTheben (1) | VI | 481–484 Thema: Mutter MatutaMatuta in RomRom (4) |
| IV | 417–431 JunoJuno zürnt der Ino wegen ihres Stolzes und wegen SemeleSemele und Bacchus; Epische Begründung des Götterzorns (15) | VI |
|