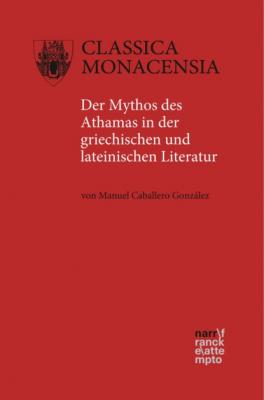ТОП просматриваемых книг сайта:
Der Mythos des Athamas in der griechischen und lateinischen Literatur. Manuel Caballero González
Читать онлайн.Название Der Mythos des Athamas in der griechischen und lateinischen Literatur
Год выпуска 0
isbn 9783823300045
Автор произведения Manuel Caballero González
Жанр Документальная литература
Серия Classica Monacensia
Издательство Bookwire
b) Ein Klagegeschrei: temptatos sensit riguis se lacertos (555). Seltsam ist, dass Ovid für diese Frau das Distributiv altera benutzt, denn sie ist nicht die zweite von zwei, sondern von vielen anderen Frauen. Gewagt ist die Verwendung von temptatos mit lacertos: Dies ergibt ein unerwartetes Bild.
c) Eine Anrufung der Wellen: Saxea facta manus in easdem porrigit undas (557).
d) Sich die Haare raufen: subito digitos in crine uideres (559).
Es gibt einen gewissen Prozess in der Versteinerung der sidonischen Frauen, genauso wie in der Fokussierung der Einzelheiten: vom Körper, der springen will, zu den Armen, die sich wünschen, auf die Brust zu schlagen, zu den nach den Wellen des Meeres sich ausstreckenden Händen, bis zu den die Haare raufenden Fingern. Die Bewegung erstarrt auf Junos Stimme hin; so müssen sie für ewig bleiben.
Allerdings leiden sie nicht alle unter einer Lähmung, ganz im Gegenteil gibt es auch einige, die nie aufhören, sich zu bewegen. Sie werden zu Vögeln, zu den Ismeniden, die im dortigen Meer die Fläche streifen258. Die Ätiologie ist ersichtlich. Eitrem beteuert, „nach Ovid. Met. IV 561fOvidMet. IV 561. wurden die Gefährtinnen der L. in αἴθυιαι verwandelt (als solche erschienen sie ja selbst dem Odysseus in der Od. a. O., vgl. Die AtheneAthene αἴθυια bei MegaraMegara)“259. Es scheint, dass ein Heiligtum von Athene ‚Aithyia‘ sich auf den nahe bei Megara liegenden Klippen befand260; dies würde die megarische Version des Mythos unterstützen. Die Frage ist meiner Meinung nach, warum Ovid zwei Arten von Metamorphosen für die sidonischen Frauen nennt. Andersons Grund ist m.E. nicht sehr überzeugend: „Birds serve as a common symbol of grief, with their piercing cries and seemingly restless flight“261. Leider wurde dafür kein anderer Vorschlag gefunden.
Abgesehen von den erwähnten Varianten für die Verse 431 und 471 sollte man folgendes Textkritikproblem ansprechen: „MSS tradition indicates convincingly that 446 was not in the Ovidian text that survived into the medieval period“262. In der Tat wird dieser Vers in MNλ ausgelassen und nicht wenige Herausgeber haben Zweifel, ob er überhaupt zum Text gehört.
Zunächst muss man mit Bömer zugeben, dass „sich der Zusammenhang auch ohne diesen Vers verstehen“263 lässt. In diesem Fall muss man ein Zeugma und das Auflösen der ‚Strafen‘ annehmen. Dieser Vers kommt zum ersten Mal in einigen Korrekturen einer früheren Handschrift vor; die Datierung dieser Änderung ist vom 12. Jh. n. Chr. Seither wurde er in alle späteren Kopien der Handschriften eingestellt. Der Korrektor264 ist sehr kritisiert geworden, weil die Strafen innerhalb der Stadt der Toten, und nicht außerhalb stattfinden. Allerdings gilt diese Kritik zwar für Vergil, aber nicht für Ovid; in den Metamorphosen kann Juno selbst in diese Gegend eintreten, obwohl sie eine olympische Göttin ist. Man könnte denken, dass die vierte Gruppierung von Toten eine Art Übergang zu Junos Ziel vorbereitet.
Bömer, der den Vers ausführlich analysiert hat, meint: „so bleibt die Entscheidung über die Echtheit des Verses letztlich subjektiv“265. Da der Hauptteil der Tradition diesen Vers nicht präsentiert und die Darstellung der Strafen als ein Fremdteil der Gesamtbeschreibung anzusehen ist, entscheidet sich Bömer, ihn beiseite zu lassen: „Der Interpolator hat dann den Versuch gemacht, das harte Zeugma artes celebrare durch artes exercere zu glätten, seine Vergilkenntnisse anzubringen und gleichzeitig, mit Hilfe Vergils, seinen christlichen Zeitgenossen ins Gewissen zu reden“266. Anderson jedoch schließt aus, „the ‘interpolator’, if he is such, is right on target“267. Heinsius, Merkel, Magnus, Mendner unterlassen seine Erwähnung268; Helm, Lafaye, Breitenback verteidigen ihn269. Anderson behält ihn in Teubners Ausgabe, im Gegensatz zu Tarrant270, in dessen Ausgabe (Oxford) er eine Zeile frei lässt und den Vers darunter in eckiger Klammer schreibt. Meiner Meinung nach könnte der Vers wie bei Teubner im Text bleiben.
Diese besondere wichtige Textstelle ist einige persönliche Endüberlegungen wert.
Die in den Metamorphosen erzählte Geschichte über Athamas und Ino könnte meiner Meinung nach als eine grandiose theatralische Darstellung angesehen werden. Das Drehbuch hat Juno geschrieben; Tisiphone hat das Werk ausgeführt; Ino und Athamas spielen die Hauptrollen; Learchos und Melikertes sind die Nebenfiguren; Bacchus ist die angeblich abwesende Figur, aber er ist immer anwesend; die sidonischen Frauen sind der dem Werk hinzugefügte Epilog. Darüber hinaus ist in dieser Darstellung nicht der Leser der Zuschauer par excellence, sondern Juno, die aus dem Olymp die ganze Aktion sieht und daran Gefallen (vgl. Vers 524) findet.
Es ergeben sich vier Sichtweisen auf das Werk: Ino und Athamas, die nur die ihnen den Wahnsinn schickende Erinnye Tisiphone sehen; Juno, die Anstifterin, die weiß, warum jene wahnsinnig geworden sind; Ovid, der die ganze Geschichte schreibt und beabsichtigt, das, was er schon in den Metamorphosen aufgezeichnet hat, in diesem Buch noch zu schreiben, und auch das, was er von dieser Erzählung schon in anderen Werken berichtet hat und was schon über diesen Mythos vor ihm geschrieben wurde; der Leser, der zu all diesen Elementen hinzufügt, was nach Ovid darüber erzählt worden ist, eine Tradition, die mit Sicherheit wiederum von diesem Dichter und seinen Ansichten beeinflusst worden ist.
Meiner Meinung nach agieren die Personen entschieden und unverzüglich: Juno ist entschlossen, zur Unterwelt zu gehen, ohne lang darüber nachzudenken; Tisiphone verlässt ihr Haus augenblicklich; Athamas ruft sofort seine Gefährten, um zur Jagd zu gehen; Ino zögert nicht, vom Steilufer zu springen; Neptun verhandelt nicht über die Gewährung der Divinisierung. Alles vollzieht sich jedoch im letzten Teil langsamer, und zwar bei der Bestrafung der sidonischen Frauen: Da ist jede Einzelheit sehr wichtig und der Prozess der Versteinerung wird schrittweise und nicht unversehens geschildert.
Ovids Beschreibung stellt auch eine große Bewegtheit vor: Juno steigt aus dem Olymp bis zur Unterwelt hinab und kehrt zum Olymp zurück; Tisiphone steigt aus der Unterwelt zum Hause von Athamas hinauf und kehrt zu ihrem Haus zurück; Athamas schreitet aus dem Palast heraus in Richtung Wald; Ino bewegt sich aus dem Wald über die Felswand zum Meer. In den beiden letzten Fällen kehren die von Wahnsinn unterjochten Hauptfiguren nicht zum Hause zurück. Der Wald und das Meer bleiben als Todesorte. Nur dank des Eingreifens von VenusVenus wird die SeeSee für Ino (und Melikertes) ein Rettungsort und eine ewige Wohnung (Heilung des Wahnsinns). Diesen Bewegungen steht die fortschreitende Unbeweglichkeit der sidonischen Frauen entgegen: Ihre Bewegungslosigkeit ist nicht ein Rettungszeichen, sondern ein Zeugnis von Grausamkeit und Bestrafung. Deswegen haben sie kein Leben, darum werden sie zu Stein271.
Es sieht nicht so aus, als bekümmerte sich Ovid darum, eine ordentliche und perfekt zusammenhängende Erzählung zu verfassen, wie es schon oben angedeutet wurde. Der Dichter zeigt verschiedene Szenen, die sich „durch Assoziationen“272 verbinden. Vergil aber präsentiert eine einheitlichere Geschichte; das kann man z.B. in der Beschreibung der Unterwelt sehen: „Zusammenfassung des ersten Abschnitts (Aen. I 50, VII 323VergilAen. VII 323VergilAen. I 50), Aufbruch und Ankunft am neuen Ort, notwendige Angaben über den Ort, bzw. die Personen der neuen Szene (Aen. I 51–63, VII 324–29VergilAen. VII 324–329VergilAen. I 51–63), dann die weitere Handlung“273. Bernbecks Behauptung über den mangelnden Zusammenhang der Erzählung bei Ovid ist jedoch m.E. ein wenig übertrieben: „Ovid legt auf die Kontinuität der Handlung keinen besonderen Wert“274. Meiner Meinung nach schlägt Ovid eine andere Art von Beschreibung vor, nämlich eine anschaulichere Erzählung, die aus diesem Grund die perfekte Verbindung und Einheit verliert.
Bernbeck zufolge275 besteht der Text aus verschiedenen Szenen, die fast unabhängig voneinander sind:
Einleitung: Grund für Junos Zorn (416–419).
Erste Szene: Junos Monolog (420–431).Einführung zur 2. Szene: Tartaros Beschreibung (432–446).
Zweite Szene: Bitte um Tisiphones Hilfe (447–480).
Dritte Szene: Tisiphones Angriff (481–511).
Vierte Szene: Athamas’ Wahnsinn und Inos SprungSprung (512–530).
Fünfte Szene: Bitte von VenusVenus und Divinisierung von