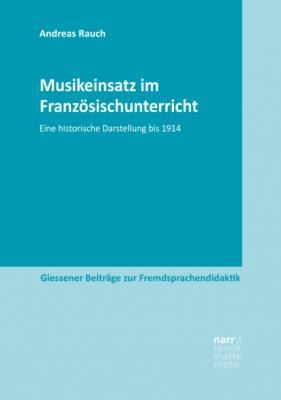ТОП просматриваемых книг сайта:
Musikeinsatz im Französischunterricht. Andreas Rauch
Читать онлайн.Название Musikeinsatz im Französischunterricht
Год выпуска 0
isbn 9783823301776
Автор произведения Andreas Rauch
Жанр Документальная литература
Серия Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik
Издательство Bookwire
Die erfolgreiche Lateinschule des Mittelalters verfuhr also im Grunde genommen genauso, wie sich […] das erfolgreiche, ‚natürliche‘ Erlernen einer zweiten Sprache vollzieht: Nicht von kleinen Einheiten, die aszendent zu immer größeren aufgebaut werden, sondern eher deszendent über den Rhythmus größerer und in sich abgeschlossenerer Sinneinheiten, die nach ihrer Haftung im Gedächtnis in weiteren Übungen ‚aufgebrochen‘ und analysiert werden.42
Diese Elemente des „singenden Lernens“ werden in den 1920er Jahren von Georg Lapper in Bayern aufgenommen und bilden die Grundlage seiner gleichnamigen Methode.43
Fazit: In der Antike44 und im Mittelalter überwiegt die mündliche Tradition. Kelly verweist mit der Formel „Ear before Eye“ darauf, dass „the introduction to language through oral skill [is] much older than many modern educators would care to admit, being found at least as early as the beginning of the Middle Ages.”45 Dies spiegelt sich auch in der formalen gregorianischen Bildungstradition der Schola cantorum46 wider, die eng mit der liturgischen mittelalterlichen Praxis verbunden war und bei der die Ausspracheschulung durch das Singen einen wichtigen Platz einnahm. Die mündlichen Fähigkeiten des Hörverstehens und Sprechens spielen damit auch historisch-genetisch eine bedeutende Rolle. Das Hörverstehen schaffte die Grundlage für die weiteren Fertigkeiten und konnte damit, wenn man das in heutigen Worten ausdrücken will, als basic skill bezeichnet werden, obwohl es damals die didaktische Konzeption der vier Grundfertigkeiten in expliziter und systematischer Form noch nicht gab.47 Daraus wurden dann als im Mittelalter gültige didaktische Maximen:
Nichts kann gesprochen werden, das nicht zuvor gehört und verstanden wurde.
Nichts kann gelesen werden, das nicht zuvor gehört, verstanden und gesprochen wurde. Nichts kann geschrieben werden, das nicht zuvor gehört, verstanden, gesprochen und gelesen wurde.48
Diese Tradition setzt sich fort bei der Entwicklung des Kirchenlieds im Rahmen der Reformation.
I. 3 Die Reformation und der Musikeinsatz im Französischunterricht
Martin Luther (1483-1546) verkörpert den Wendepunkt zwischen Mittelalter und Neuzeit. Er kann nicht nur als theologischer Kopf der Reformation gesehen werden: Es handelt sich um eine durchaus komplexe Persönlichkeit, dessen Bedeutung für die Kultur- und Musikgeschichte unbestritten ist. Seine Bibelübersetzung ermöglichte eine Normierung der deutschen Sprache und damit auch eine weitgehende Verbreitung und Demokratisierung der heiligen Schrift, denn von nun an konnte der einfache (lateinunkundige) Bürger die Bibel in seiner Muttersprache lesen. Luther zielte auf die Volkssprache, wie er 1530 im Sendbrief vom Dolmetschen formuliert:
Man mus nicht die buchstaben inn der lateinischen sprachen fragen, wie man sol Deutsch reden, wie diese esel thun, sondern, man mus die Mutter im hause, die Kinder auf den Gassen, den gemeinen man auff dem marckt drumb fragen, und den selbigen auff das maul sehen, wie sie reden, und darnach dolmetschen, so verstehen sie es den und mercken, das man Deutsch mit jn redet.1
Bei der Verbreitung der Bibelübersetzung Luthers wirkte der Buchdruck als entscheidender Katalysator in der Verbreitung der neuen Religion. Im Folgenden sollen vor allem die Bedeutung Luthers einerseits als Musiker und Komponist, andererseits als Erzieher und Pädagoge sowie die Anwendung seiner Prinzipien für den Sprachunterricht dargestellt werden.
Die Musik und vor allem das Lied nehmen im Bildungswesen der Zeit des Humanismus eine Sonderstellung ein, da sie „[…] in einzigartiger Weise verschiedenartigen Aspekten der Pädagogik, der Religion, der Wissenschaft und der Musikpflege [unterliegen].“2 Wolfgang Niemöller verweist auf das Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Fachdisziplin innerhalb der septem artes liberales und künstlerischer, „poetischer“ Ausdrucksform.3 Bis zum 16. Jahrhundert war die Musikausbildung innerhalb des Quadriviums4 eine Art Mischung aus Arithmetik und Musik.5 Luther stellt dieser musica theoretica eine realitätsnahe musica practica6 entgegen. So spielt der Musikeinsatz7 im Unterricht in Luthers Bildungskonzeption eine zentrale Rolle:
Musicam habe ich allzeit lieb gehabt. Wer dies Kunst kann, der ist guter Art, zu allem geschickt. Man muß Musicam von Noth wegen in Schulen behalten.8 Ein Schulmeister muß singen können, sonst sehe ich ihn nicht an. Man soll auch junge Gesellen zum Predigtamt nicht verordnen, sie haben sich denn in der Schule in der musica wohl versucht und geübet.9
Die Verbindung der mittelalterlichen Lateinschule mit der Kirchenmusik wies der musica neben dem Latein auch als Lehrfach eine wichtige Stellung zu. Niemöller10 hat nachgewiesen, dass der rector scholae im Normalfall auch gleichzeitig, gewissermaßen in Personalunion, der rector chori als cantor war. Dies geschah aus soziologischen, berufsrechtlichen und häufig auch finanziellen Gründen. Oft wurden Neugründungen von Schulen unter der offiziellen Begründung vorangetrieben, dass dadurch der feierliche liturgische Gesang in der Kirche erhalten werden konnte. Der Schulmeister sollte zuerst dem Chor und dann erst der Schule vorstehen.11
Das Singen der Schulchöre diente dem Lob Gottes, und dazu sollten alle Gläubigen angehalten werden, in ihrer Muttersprache mitzusingen.12 Die Kirchgemeinde wurde im Gottesdienst aktiv einbezogen. Anstelle des Gregorianischen Gesangs stellte Luther ein Repertoire von Chorälen zusammen.13
Die Formel des Singens und Sagens taucht wiederholt bei Martin Luther auf. Johannes Block verweist auf die Botschaft des Evangeliums, die singend und sagend zum Menschen kommt.14 Es handelt sich um eine Verstehensmethode: „Theologie wird unter Gesang getrieben und kommt unter Gesang zum Verstehen.“15 Block untersucht diese Beziehung von verbum und vox16 bei Luther:
Die Propheten haben keine Kunst derart gebraucht wie die Musik, weil sie ihre Theologie […] in Musik gesetzt haben, so daß sie Theologie und Musik engstens verbunden haben, wenn sie die Wahrheit in Psalmen und Liedern verkündigten.17 […] Den nächsten Platz nach der Theologie gebe ich der Musik. Das ist durch das Beispiel Davids und aller Propheten offenbar, die all das ihr in Versmaßen und Gesängen überliefert haben.18
Luthers Bedeutung für das Kirchenlied mündet in die Rolle der Reformation als Singbewegung.19 Er dichtete 36 Kirchenlieder, bei mindestens 20 dieser Lieder stammen die Melodien sicher von ihm selbst:20 „Erst die Noten machen den Text lebendig.“21 Viele Kirchenlieder von Luther greifen nach dem Prinzip der Kontrafaktur22 vorreformatorische deutsche Lieder, aber auch lateinische Gesänge der katholischen Kirche,