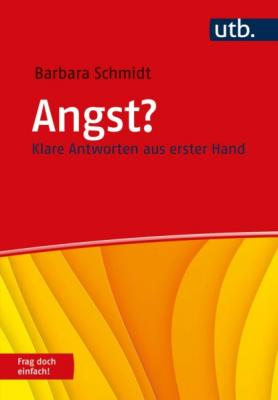ТОП просматриваемых книг сайта:
Angst? Frag doch einfach!. Barbara Schmidt M.
Читать онлайн.Название Angst? Frag doch einfach!
Год выпуска 0
isbn 9783846356876
Автор произведения Barbara Schmidt M.
Жанр Документальная литература
Серия Frag doch einfach!
Издательство Bookwire
Der kleine AlbertAlbert symbolisiert also zum einen die Übertragung des Prinzips der klassischen Konditionierung auf den Menschen, zum anderen bietet das historische Experiment eine Erklärung, wie Angst entstehen kann.
Wie lässt sich erlerntes Angstverhalten wieder „verlernen“?
Der kleine Albert kam leider nicht in den Genuss einer experimentellen Löschung, genannt ExtinktionExtinktion, seines gelernten Angstverhaltens. Im Artikel von WatsonWatson, John B. und RaynerRayner, Rosalie steht, dass er plötzlich nicht mehr verfügbar war, sonst hätten sie verschiedene Methoden ausprobiert, wie die gelernte Angst wieder verlernt werden kann. Heute wird im Rahmen der VerhaltenstherapieVerhaltenstherapie Patient:innen ein solches Verlernen von Angst beigebracht. Sie lernen dabei, dass der neutrale Reiz, also die Ratte im Beispiel vom kleinen Albert, doch nicht zwingend mit dem lauten Geräusch verbunden ist, das ursprünglich die Angst erzeugt hat. In der Therapie gehen die Patient:innen dann zum Beispiel auf öffentliche Plätze und lernen, dass sie das aushalten können, oder steigen auf einen hohen Turm und lernen, dass das gar nicht so schlimm ist wie erwartet. Dieses Verfahren heißt → ExpositionExposition und wirkt gut bei spezifischen Angststörungen.
Was passiert bei der Extinktion von Angstverhalten?
Durch die Therapie wird die Angst-Gedächstnisspur mit einer neuen Gedächtnisspur überschrieben. Die ursprüngliche, angstauslösende Gedächstnisspur wird also nicht „gelöscht“, sondern lediglich überdeckt. Daher ist ein erneutes Aktivieren der Angst-Gedächtnisspur leicht möglich.
Im Fall vom kleinen Albert konnten WatsonWatson, John B. und RaynerRayner, Rosalie beobachten, dass der kleine Albert spontan seinen Daumen in den Mund nahm, wenn der angstmachende Reiz auftrat, also entweder der laute Schlag auf das Stahlrohr oder die bereits negativ konditionierte weiße Ratte. Das Nuckeln an seinem Daumen beruhigte den kleinen AlbertAlbert offensichtlich. Watson und Rayner berichten, dass sie dem kleinen Albert für die Filmaufnahmen immer wieder den Daumen aus dem Mund nehmen mussten, damit er auch die erwünschte Angstreaktion zeigte.
Es gibt also offensichtlich Verhaltensweisen, die in beängstigenden Situationen helfen können. Diese Erkenntnis hilft bei der Therapie von Angst. So ist es den Patient:innen während der → ExpositionExposition, also der bewussten Konfrontation mit dem angstauslösenden Reiz, verboten, auf sogenanntes SicherheitsverhaltenSicherheitsverhalten auszuweichen. Die Patient:innen dürfen also keine Strategien anwenden, die die Angstreaktion abschwächen. Der Grund hierfür ist, dass die Patient:innen nur lernen können, mit der gefürchteten Situation oder dem gefürchteten Objekt zurechtzukommen, wenn sie sich der Situation oder dem Objekt ganz ausliefern. Wenn sie hierbei Sicherheitsverhalten zeigen würden, würden sie lernen, dass dieses Sicherheitsverhalten wichtig ist, um die Situation oder das Objekt zu ertragen. Was sie aber lernen sollen, ist, dass sie ohne jedes Sicherheitsverhalten in der Lage sind, die Situation oder das Objekt zu ertragen.
Außerdem geht man davon aus, dass der Körper einen sehr starken Erregungszustand, wie er bei starker Angst auftritt, nicht sehr lange aufrechterhalten kann und dieser Erregungszustand dann bald abnimmt. Wenn die Patient:innen merken, dass ihr Erregungszustand in der gefürchteten Situation merklich nachlässt, kann das zu einer neuen Gedächtnisspur führen, die mit Angst inkompatibel ist.
Linktipps |
In einem zweiten Video stellt psychologeek das Experiment mit dem kleinen Albert zusammen mit zwei weiteren sehr bekannten und ethisch bedenklichen Experimenten aus der Psychologie vor. In diesen Experimenten geht es zum einen um das bereitwillige Ausführen von Befehlen, bei denen eine andere Person vermeintlich durch Elektroschocks geschädigt wird (Milgram-ExperimentMilgram-Experiment), und zum anderen um die sehr schnelle Übernahme von zugewiesenen Gefängniswärter- und Gefängnisinsassenrollen, verbunden mit der Ausübung von Gewalt (Stanford-Prison-ExperimentStanford-Prison-Experiment):
Was ist klassisches Konditionieren?
Klassisches KonditionierenKonditionierungklassische beschreibt den Lernprozess, durch den eine von einem unkonditionierten Reiz ausgelöste Reaktion auf einen ehemals neutralen Reiz übertragen werden kann. So wird aus einem neutralen Reiz ein konditionierter Reiz oder, wie es Pawlow eigentlich ausdrücken wollte, ein konditionaler Reiz. Beim kleinen AlbertAlbert war der neutrale Reiz die weiße Ratte. Der unkonditionierte Reiz war der laute Schlag auf das Stahlrohr, dass bei kleinen Kindern generell eine Schreckreaktion hervorruft. Über die Paarung des neutralen Reizes mit dem unkonditionierten Reiz wird nun diese Schreckreaktion auf den ehemals neutralen Reiz übertragen. Beim kleinen Albert war das die gleichzeitige Präsentation der weißen Ratte und des lauten Geräusches. Die Phase, in der die beiden Reize gepaart werden, nennt man LernphaseLernphase. Das Ergebnis der Konditionierung wird dann in der nächsten Phase sichtbar, wenn der zuvor neutrale Reiz nun allein präsentiert wird und die konditionierte Reaktion auslöst. Beim kleinen Albert bedeutet das: Die weiße Ratte allein löst schon eine Schreckreaktion aus. In der Extinktionsphase, die der kleine Albert leider nicht mehr mitbekam, wäre die weiße Ratte so oft ohne das erschreckende Geräusch präsentiert worden, dass sich die Schreckreaktion auf die weiße Ratte langsam abgeschwächt hätte. Jedoch zeigt die Forschung, dass in der Extinktionsphase eigentlich keine Löschung der Gedächtnisspur stattfindet. Durch eine wiederholte Konditionierung oder sogar spontan kann sehr schnell wieder die Kopplung zwischen dem neutralen Reiz und der konditionierten Reaktion hergestellt werden. Man geht davon aus, dass sich eine stabile Gedächtnisspur gebildet hat, die leicht wieder reaktiviert werden kann.
Literaturtipp
Woher stammt der unkonditionierte Reiz bei gelernten Ängsten?
Die Frage, die bei der Recherche zur → klassischen Konditionierung als Grundlage für → Angststörungen auftaucht, ist: Woher stammt der unkonditionierte Reiz? Der unkonditionierte Reiz ist derjenige Reiz, der von sich aus eine Angstreaktion auslöst, sprich, ohne erlernt zu sein. Beim Fall des kleinen AlbertAlbert ist es das laute Geräusch, vor dem Albert von Natur aus Angst hat. Dieser unkonditionierte Reiz wird gepaart mit dem konditionierten Reiz,