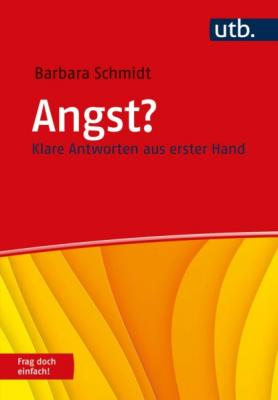ТОП просматриваемых книг сайта:
Angst? Frag doch einfach!. Barbara Schmidt M.
Читать онлайн.Название Angst? Frag doch einfach!
Год выпуска 0
isbn 9783846356876
Автор произведения Barbara Schmidt M.
Жанр Документальная литература
Серия Frag doch einfach!
Издательство Bookwire
Was ist eine posttraumatische Belastungsstörungposttraumatische Belastungsstörung?
Bei einer posttraumatischen Belastungsstörung ist der AuslöserAuslöser der Störung ein traumatisches Ereignis. Das sind häufig Missbrauchserfahrungen oder Erfahrungen im Krieg, die dazu führen, dass die Erinnerungen an diese Erlebnisse einfach so wieder auftauchen und das tägliche Leben stark stören. Frauen sind auch hier stärker betroffen als Männer. Man geht davon aus, dass traumatische Erinnerungen anders abgespeichert werden als normale Erinnerungen. Die traumatischen Erinnerungen sind somit nicht an einen bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit gebunden wie andere Erinnerungen. Sie können, oft ausgelöst durch einen bestimmten Reiz oder eine bestimmte Situation, wieder erlebt werden, als würde das ursprüngliche Erlebnis gerade noch einmal stattfinden. Dies ist sehr belastend für die Betroffenen und kann auch zu sogenannten dissoziativen Phänomenendissoziatives Phänomen führen. Das bedeutet beispielsweise, dass man vor allem in akuten Stresssituationen auf einmal gefühllos wird oder sich auf einmal von außen sieht, als wäre man nicht mehr in seinem eigenen Körper.
Linktipp
Wie werden Angststörungen klassifiziert?
Die genauen Definitionen der einzelnen → Angststörungen sind weltweit im → ICD-11 erfasst. Das ICDICD (englisch: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO herausgegeben. Die Zahl 11 gibt an, dass es sich um die 11. Revision handelt. Diese ist seit Anfang 2022 in Kraft. Die Umstellung von ICD-10 auf ICD-11 erfolgt nach und nach. Nach diesem System werden weltweit Diagnosen vergeben. Daneben gibt es noch ein weiteres Klassifikationssystem, das DSM, das für „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ steht. Das DSM wurde von der American Psychiatric Association (APA) entwickelt und wird weltweit für Forschungszwecke verwendet. Die aktuelle Version ist das DSM-5, das 2013 veröffentlicht wurde. Im DSM sind nur psychische Diagnosen enthalten, im ICD sind dagegen alle Diagnosen enthalten. Um mit den Krankenkassen abzurechnen, wird das ICD verwendet. Der Code einer Diagnose setzte sich im ICD-10, der aktuell noch verwendet wird, zusammen aus einem Buchstaben von A bis Z an erster Stelle und einer zweistelligen Ziffer an zweiter und dritter Stelle. Darüber hinaus können noch weitere Zahlen nach einem Punkt als Unterklassifikation dienen. Die Diagnosen für psychische Störungen finden sich im ICD-10 bei F0 bis F9, wobei Angststörungen unter F4 gelistet sind. Die Agoraphobie hat beispielsweise den Code F40.0, eine Agoraphobie mit Panikstörung den Code F40.01. Spezifische → Phobien sind unter F40.2 gelistet. F41 sind die anderen Angststörungen, F42 die → Zwangsstörung und F43.1 ist die Posttraumatische Belastungsstörung. Im Alltag begegnet man dem ICD bei einer Krankschreibung oder Überweisung, auf der die gestellte Diagnose in Form eines ICD-10-Codes steht.
Linktipp |
Hat der Mensch schon immer Angst?
In diesem Kapitel geht es um die faszinierenden Mechanismen, mit denen unser Körper ausgestattet ist, um uns vor Gefahr zu bewahren. Unser Gehirn und unser Körper sind darauf eingestellt, Gefahren zu antizipieren und sie zu bewältigen. So wird das Überleben gesichert. Genau dieses Antizipieren von Gefahren ist aber auch mit Angst verbunden.
Angst ist also ein lebenswichtiges Alarmgefühl. Es ist zunächst unangenehm und beklemmend, hat aber zum Ziel, akute Gefahren abzuwehren. Wichtig ist, dass das Gefühl der Angst wieder aufhört, wenn die Gefahr überwunden ist. Leider haben wir oft Angst, obwohl gar keine akute Gefahr droht. Dies beruht auf der Fähigkeit des Menschen, sich Dinge vorzustellen, die passieren könnten. Der Vorteil daran ist, dass sich der Mensch so auf Gefahren vorbereiten kann, die noch gar nicht eingetreten sind. Nachteilig ist es, wenn die negativen Gedanken bezüglich der Zukunft überhandnehmen. Dann wird das Gefühl der Angst zur Belastung. Um zu verstehen, wie Angst entsteht und was dabei im Körper passiert, habe ich im folgenden Kapitel aktuell diskutierte Theorien zur Entstehung von Angst zusammengetragen.
Linktipp
Welche Rolle spielt Lernen bei der Entstehung von Angst?
Bei der Entstehung von Angst kommt das bekannte Experiment mit dem kleinen AlbertAlbert ins Spiel, ein ExperimentLittle-Albert-Experiment, das unter heutigen ethischen Standards nicht mehr denkbar wäre. Der kleine Albert war nicht mal ein Jahr alt, als ihm John B. WatsonWatson, John B. und Rosalie RaynerRayner, Rosalie an der Johns-Hopkins-Universität um 1920 verschiedene Tiere präsentierten. Aufgrund seines geringen Lebensalters konnte man davon ausgehen, dass Albert noch keine Vorerfahrungen mit den Tieren hatte, die ihm in diesem Experiment präsentiert wurden. Der kleine Albert war zunächst angetan von dem kleinen Affen, dem Kaninchen, dem Hund und vor allem der weißen Ratte. Dann erschreckten die beiden Versuchsleiter den kleinen AlbertAlbert mit einem lauten Schlag auf ein Stahlrohr immer dann, wenn er gerade mit der weißen Ratte spielen wollte. Mit der Zeit hatte der kleine Albert auch dann Angst vor der Ratte, wenn der laute Schlag fehlte. John B. Watson und Rosalie Rayner hatten also experimentell eine → PhobiePhobie bei dem kleinen Albert erzeugt: Er hatte Angst vor der weißen Ratte. Sie testeten daraufhin auch, ob sich die Angst nur auf den spezifischen Reiz, also zum Beispiel die weiße Ratte, oder auch auf andere flauschige Objekte wie einen Nikolausbart übertrug. Das Ergebnis war, dass Albert nicht nur Angst vor der weißen Ratte hatte, die er vorher gerne gestreichelt hat, sondern auch vor anderen flauschigen Dingen. Die Angst hatte sich also generalisiert; sie wurde von der weißen Ratte auf andere flauschige Gegenstände übertragen (Watson & Rayner, 1920).
Der Versuchsaufbau des berühmten Experiments mit dem kleinen Albert. John B. Watson schlägt mit einem Hammer auf ein Metallrohr. Vor diesem Geräusch hat der kleine AlbertAlbert Angst. Nun wird dieses Geräusch