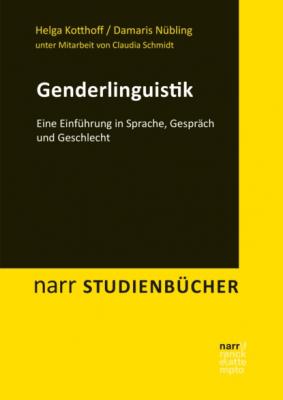ТОП просматриваемых книг сайта:
Genderlinguistik. Helga Kotthoff
Читать онлайн.Название Genderlinguistik
Год выпуска 0
isbn 9783823301523
Автор произведения Helga Kotthoff
Жанр Документальная литература
Серия narr studienbücher
Издательство Bookwire
It remains a problem, for either explanation, why the animates, among the feminines, did not build up sufficient resistance against this development, if the case distinction had a high functional load for them. (Krifka 2009, 153).
Die deutsche Sprachgeschichte kennt durchaus Beispiele für morphologischen Widerstand gegen lautgesetzlichen Sprachwandel (so erfasst die e-Apokope zwar den Dat.Sg., nicht aber den Plural, s. dem Tag(e) vs. die Tag-e). Hier wurde jedoch eine wichtige Distinktion aufgegeben, die bei femininen Nomen (worunter sich die meisten Frauenbezeichnungen befinden) auf die Information Agens vs. Patiens verzichtet. Dass auch die feminine gemischte Flexionsklasse im Frühnhd. sämtliche Kasus aufgegeben hat, wurde bereits gesagt (Reste: mit MutterMuttern, ich habe MutternMutter gesehen). Hierbei handelt es sich um keinen phonologischen (es gibt keinen n-Schwund), sondern um einen morphologischen Prozess. Krifka (2009) erklärt diese Kasusnivellierung mit der historischen Ungleichbewertung der Geschlechter, wo Frauen daran gehindert wurden, Handlungsträgerschaft zu übernehmen und damit in Agensrollen zu treten. Dieser Sexismus habe sich in die Grammatik eingefräst:
One possible reason why the functional load of case distinction might have been less prominent with feminines than with masculines is that female referents are lower on the (linguistic) animacy scale than male referents. This might be an effect of a sexist speech community, or a sexist perception within the speech community, in which females are less likely to resume the agent role. There is little doubt that sexism is behind the so-called generic use of the masculine gender, as in someone left his lipstick in the bathroom, and the generic use of expressions like chairman. […] Case syncretism in feminine nouns would then be nothing else than another case of built-in sexism of language. (153f.)
This finding [keine Nom./Akk.-Unterscheidung bei Feminina] can be interpreted straightforwardly as evidence of a sexist society in which the denotation of feminine NPs occur less frequently in the agent role than the denotation objects of masculines; the need to distinguish agent and patient would then be less pressing for feminines. (165)
Schließlich muss man auch einen Blick auf die Genitivmarkierung werfen: Auch hier gilt, dass Feminina früher eine hatten, heute aber nicht mehr.2 Auch der mit dem Dativ synkretistische (homophone) Artikel der (Singular) trägt dazu wenig bei. Tab. 4-3 ist zu entnehmen, dass der Genitiv typischerweise die Possessor-Rolle markiert, also i.d.R. eine Person, die etwas oder jemanden besitzt (Besitzrelation) oder der etwas oder jemand gehört (Zugehörigkeitsrelation). Damit ist der Possessor eine mächtige Person, die über etwas oder jemanden verfügt. Alle Maskulina (und auch Neutra) markieren den Genitiv sehr salient, nämlich im Singular (heute oft als noch einzigen Kasus) über -(e)s: des Mann-(e)s, des Lehrer-s, des Hund-es. Dieses Genitiv-s ist stabil und tritt auch an Fremdwörter. Auch der Artikel des markiert monofunktional (d.h. mit hoher Signalstärke) Genitiv Singular bei Maskulina und Neutra. Innerhalb der Familie werden und wurden Zugehörigkeiten über Genitivkonstruktionen mitgeteilt, wobei hier fast nur Väter und Ehemänner als Possessoren auftreten, manchmal auch Berufsausübende (Pfarrers Kinder, Müllers Vieh …). Dialektal sind solche Possessivkonstruktionen wie (s) Meiers Grete noch erhalten (Kap. 9.3). In welchem Ausmaß früher Männer häufiger als Frauen die Possessorposition innehatten bzw. noch heute besetzen, ist nicht bekannt und ein weiteres offenes Thema. Auch die Dativmarkierung erfolgt wenn, dann bei Maskulina und Neutra, aber nicht (mehr) bei Feminina. Allerdings wird sie in ihrer Form als -e kaum noch verwendet (dem Mann(e), im Wald(e)).
Weitere Evidenz dafür, dass Bezeichnungen für Frauen tiefer auf der (sozial induzierten) AnimatizitätsskalaAnimatizitätsskalaBelebtheitshierarchieBelebtheitshierarchie liegen als solche für Männer, wurde bereits genannt: Bei der Räumung der schwachen Maskulinklasse wurden unbelebte Entitäten in die neue n-Klasse überführt, schwach belebte (Pflanzen, Fische, Insekten etc.) dagegen zu den Feminina umsortiert. Stärker belebte, aber nicht-humane Lebewesen (Vögel, Säuger) bleiben Maskulina und wandern in andere Flexions-, aber eben nicht Genusklassen ab. Wie das Verhältnis zwischen Flexions- und Genusklassifikation genau beschaffen ist, wie es sich diachron wandelt und welche Hinweise auf (historische) Geschlechterordnungen es uns liefert, ist noch unzureichend erforscht und verstanden.
4.3 Genus und Geschlecht
Genus ist ein jedem Substantiv inhärenter Klassifikator, dem selbst keine Semantik (Bedeutung) zukommt. Die Tafel hat nichts Weibliches an sich ebensowenig wie der Stuhl etwas Männliches, und das Fenster ist nicht ‚sächlicher‘ als die beiden anderen Objekte. Genus trägt (in aller Regel) nichts zur Bedeutung des Substantivs bei (außer beim sog. DifferentialgenusDifferentialgenus, s.u. in 4.2.2). Deshalb kommen Sprachen gut ohne Nominalgenus aus (man betrachte nur das Englische, Türkische, Finnische). Umgekehrt kann aber Genus mit einiger Wahrscheinlichkeit aus der Bedeutung des Substantivs abgeleitet werden (die sog. GenuszuweisungGenuszuweisung erfolgt dann semantisch): Substantive, die Frauen bezeichnen, haben eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, feminin zu sein – und solche, die Männer bezeichnen, maskulin. Dabei drücken Frau, Tante, Nachbarin, Nonne bereits als Lexeme ‚weibliches Geschlecht‘ aus, ihr feminines Genus macht sie nicht weiblicher (umgekehrt ebenso bei Männerbezeichnungen). Genus dockt also an die Bedeutung (Semantik) des Substantivs an und wird dadurch beherrschbarer. Es gibt ein paar weitere semantische Zuweisungsprinzipien, z.B. sind Früchte fast ausnahmslos feminin (die Pflaume, Mango, Ananas), Alkoholika sind oft maskulin (der Wein, Whiskey, Amarula), Stoffe und Flüssigkeiten oft neutral (das Eisen, Erz, Wasser, Blut). Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit solchen Bezügen zwischen (grammatischem) Genus und (sozialem und biologischem) Geschlecht. Da auch viele Tierbezeichnungen dem sog. Genus-Sexus-PrinzipGenus-Sexus-Prinzip unterliegen, werden wir die biologische Kategorie Geschlecht (Sexus) nicht verwerfen. Auch die meisten Menschen identifizieren sich mit ihrem biologischen Geschlecht und sind insofern Weibchen und Männchen. Was sie durch mehr oder weniger hingebungsvolles doing gender daraus machen bzw. darauf aufsatteln, hat mit Sexus logisch nichts zu tun und macht sie