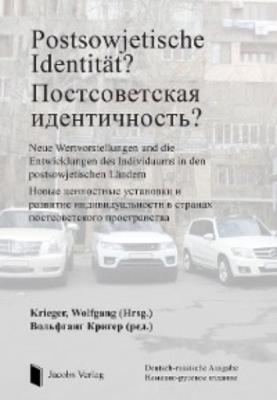ТОП просматриваемых книг сайта:
Postsowjetische Identität? - Постсоветская идентичность?. Wolfgang Krieger
Читать онлайн.Название Postsowjetische Identität? - Постсоветская идентичность?
Год выпуска 0
isbn 9783899188264
Автор произведения Wolfgang Krieger
Жанр Социология
Издательство Автор
Veranschaulichen wir diese sechs Varianten der Differenz und das ihnen zuzuordnende Identitätsverständnis jeweils an einem Beispiel.
1 Herr Ivanov ist immer noch derselbe, so cholerisch und jähzornig, wie er schon als Kind war (Identität durch zeitliche Kontinuität),
2 Herr Ivanov ist derselbe, egal ob er zuhause herumschreit oder bei der Arbeit (Identität durch Unveränderlichkeit im Raum),
3 In beidem, sowohl in seinen Entscheidungen wie auch in seinen Fragen kann man erkennen, dass Herr Ivanov sich immer vom Prinzip der Gleichberechtigung leiten lässt (Identität durch eine übergeordnete Konstante),
4 Herr Ivanov ist durch und durch ein Moskauer Fußballer, denn er hat fünfzehn Jahre bei Spartak Moskau gespielt und ist immer dem Verein treu geblieben (Identität durch gemeinsames Schicksal bzw. Integration),
5 Auch wenn Herr Ivanov fünfzehn Jahre bei Spartak gespielt hat, so bleibt er doch ein Ukrainer in seinem Wesen (Identität durch Abgrenzung einer inneren Wesenheit),
6 Ob sie nun lang und dünn ist oder kurz und dick, wenn sie oben eine Öffnung hat und unten einen Fuß und man sie mit Wasser füllen kann, ist es eine Vase (Identität durch gemeinsame Merkmale).
Alle sechs Varianten – es mag noch weitere geben – zeigen, dass die Zuschreibungen von Identität zuvor die Setzung einer Nicht-Identität benötigen, also eine Unterscheidung voraussetzen. Kurzum: Ohne Differenz keine Identität.
Diese Setzung einer Nicht-Identität ist die Voraussetzung für den Vergleich der beiden Phänomene. Sie sind vereint in einem Dritten, welches ohne die Schaffung einer Differenz die beiden Phänomene noch gar nicht zu erkennen geben könnte. In unserem Beispiel ist die Beobachtung von Herrn Ivanov jenes Dritte, in welchem zwei Phänomene, etwa Herr Ivanov heute und gestern, hervortreten, indem die Einführung einer Beobachtung von zeitlicher Differenz seine Einheit spaltet. Diese Beobachtung einer zeitlichen Differenz ist regelrecht eine Operation des Unterscheidens jenes Dritten in zwei einander gegenübergestellte Phänomene, nämlich Herr Ivanov heute und Herr Ivanov gestern. Die Gegenüberstellung schafft die Basis für die Möglichkeit des Vergleiches, sie schafft dem Vergleich die Objekte einer weiteren Beobachtung, die nun ihrerseits weitere Unterscheidungen vollzieht.
Diese Betrachtung der Identität schließt an an die Logik des Unterscheidens von George Spencer-Brown in seinen „Gesetzen der Form”.7 Sie ist auch insofern für ein Konstrukt der „postsowjetischen Identität” bedenkenswert, als sie darauf hinweist, dass jede Operation des Unterscheidens und damit des Beobachtens auch einen „unmarked space”, einen Raum des Nichtbeobachteten hinterlässt, d. h., indem sie etwas Bestimmtes beobachtet, gerade anderes von der Beobachtung ausschließt. Jeder Unterscheidung, die vollzogen wird, geht eine andere Unterscheidung voraus, in der entschieden wird, was beobachtet werden soll und was nicht. Insofern ist jede Unterscheidung „voreingenommen”, „vorbelastet” durch eine nicht unbedingt bewusste Routine der Beobachtungsoperationen und einen nicht unbedingt reflektierten Beobachtungswillen.
Dieser Aspekt ist auch für die Suche nach identitätsrelevanten Parametern in Persönlichkeitsstrukturen, im sozialen Handeln, in sozialen Institutionalisierungs-prozessen und in kulturellen Ausdrucksformen in Rechnung zu stellen. Wer nach Identität sucht, bringt schon einen Fundus an Hypothesen mit über Faktoren, die er für den Fortbestand der Person, der Gesellschaft, der Kultur als wahrscheinlich unverzichtbar vermutet und die seine Suche daher immer schon in bestimmte Wege leiten. Die Begriffe, denen das Postulat von Identität zugesprochen wird (Persönlichkeit, Gesellschaft, Kultur) sind es nicht zuletzt auch selbst, die jene Voreingenommenheit schon konstituieren; denn sie rekurrieren auf relativ konstant bleibende Parameter, grenzen Systeme ab von anderen Systemen und verpflichten so schon zur Suche nach dem unveränderlichen Merkmal, das die Unterschiede ausmacht. „Identität” ist daher schon den Begriffen der Persönlichkeit, der Gesellschaft, der Kultur und vielen anderen Begriffen immanent, die in der Vielfalt der sich wandelnden Erscheinungen lebendiger Systeme das Stabile und Gleichbleibende auszeichnen.
Der Gebrauch des Begriffes Identität ist also auch hinsichtlich des Referenzobjektes vielfältig. Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen der Identität des Individuums und der Identität von Kollektiven (die auf Zuschreibungen des/der internen oder externer Beobachter*innen beruhen kann). Für den Begriff des „kollektiven Identität“ ist ferner zu unterscheiden, ob die Zuschreibungen dem Kollektiv selbst oder der Zugehörigkeit eines Indidivuums zu einem Kollektiv gelten. Für letztere gilt, dass das Individuum so viele kollektive Identitäten haben kann, wie es Mitglied von Kollektiven ist. Die kollektiven Identitäten des Individuums bilden zusammen mit der individuellen Identität seine „personale Identität“.8
Ein Beispiel: Von kollektiver Identität kann die Rede sein, wenn ein Kollektiv, etwa die Mitglieder einer bestimmten Ethnie, durch besondere Merkmale gekennzeichnet scheint. Beschrieben wird dann die „kollektive Identität“ dieses Kollektivs. Freilich gelten dann diese Merkmale auch für jedes Mitglied. Nun ist die „kollektive Identität“ Teil seiner „personalen Identität“ und bezeichnet eine Zugehörigkeit zum Kollektiv. Desweiteren aber enthält die „personale Identität“ auch die individuelle Identität im Sinne einer Vielzahl von Merkmalen, die in relativ einmaliger Kombination die Besonderheit des Individuums jenseits seiner kollektiven Identitäten beschreiben. Insofern Individuen mehreren Kollektiven zugehörig sind, kommen ihnen auch mehrere kollektive Identitäten zu,9 welche sie in ihrer „personalen Identität“ auf individuelle Weise gewichten und möglicherweise versuchen miteinander vereinbarlich oder für einander nützlich zu machen.
Die Konstruktionen kollektiver Identität lassen sich durch eine weitere Systematik hinsichtlich der wichtigsten Kriterien für die Zugehörigkeit unterscheiden. Sohst sieht ein historisches Entwicklungsmodell veschiedener Formen kollektiver Identität, die auf dem jeweils bestehenden Menschenbild der jeweiligen Epoche und den kulturell praktizierten Zuschreibungen von sozialen Zugehörigkeitsparametern beruhen. Für maßgeblich für die Art der Zugehörigkeitsattributionen hält er die zeitliche Orientierung der kollektiven Identität. Er unterscheidet eine „archaische Proto-Identität“, die etwa bis 40.000 Jahre vor Christus verbreitet gewesen sein dürfte und deren Zuschreibungen unabhängig von zeitlichen Differenzierungen erfolgt sind und sich auf die je aktuelle Zugehörigkeit zu einer Sippe oder Familie beschränkte, eine darauf folgende Abspaltung einer individuellen, wie sie etwa in der griechischen Antike in der „Erfindung des Individuums“ beobachtet werden kann, von einer „kollektiv-anzestral orientierten Identität“, für welche eine herkunfts- und damit vergangenheitsbezogene Orientierung kennzeichnend ist (etwa im Ahnenkult symbolisiert), sodann einer „präsentisch kollektiven und individuellen Identität“ ab etwa 1550, die die Zugehörigkeit durch gegenwartsbezogene Merkmale definiert, etwa durch die Nützlichkeit für die gegenwärtige Situation, wie sie der Utilitarismus des Hobbes’schen Rationalismus beispielweise beschwört, und schließlich einer „programmatisch zukunftsorientierten kollektiven wie auch individuellen Identität“, deren Zugehörigkeitsmerkmale auf der individuell gewollten Teilhabe an einem kollektiven Programm bzw. auf individuellen Zielen für einen zukünftig zu erreichenden Zustand beruht.10
Diese Typik bzw. „Entwicklungslogik“ der Identitätskonstruktionen lässt sich möglicherweise auch als analytisches Instrument zur Erklärung von Identitätsdifferenzen zwischen westlich-individualistischen Kulturen und östlich-kollekti-vistischen Kulturen heranziehen, da sie auf Merkmale rekurriert, die für die heutigen westeuropäischen Kulturen und die postsowjetischen Kulturen zumindest von sehr unterschiedlichem Gewicht sind, wenn nicht gar grundsätzlich differieren. So verweisen nationalistische und ethnizistische Identitätskonstruktionen stets in ihrem Kern auf den Typus einer „kollektiv-anzestral orientierten Identität“11, während Identitätskonstruktionen, die dem Gedanken einer individuellen Selbstverwirklichung und einer dem gesellschaftlichen Fortschritt dienlichen Lebensweise dem Typus einer „programmatisch zukunftsorientierten Identität“ zuzurechnen sind. Allerdings muss davon ausgegangen werden, dass die von Sohst mit dem Anspruch einer epochalen Begrenztheit erarbeiteten Typen in den heutigen pluralen