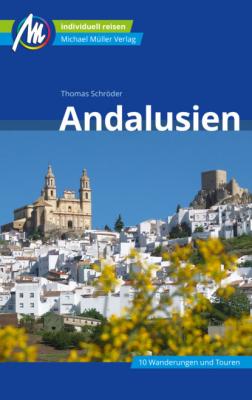ТОП просматриваемых книг сайта:
Andalusien Reiseführer Michael Müller Verlag. Thomas Schröder
Читать онлайн.Название Andalusien Reiseführer Michael Müller Verlag
Год выпуска 0
isbn 9783956548499
Автор произведения Thomas Schröder
Жанр Книги о Путешествиях
Серия MM-Reiseführer
Издательство Bookwire
Zweiter Bereich (Segundo Recinto): Er ist der älteste Abschnitt und gleichzeitig das Herz der Alcazaba. Hier residierten die maurischen Herrscher, umgeben von ihrem Hofstaat und den Wachen. Es muss eine richtige Palaststadt gewesen sein, mit Moschee, Badeanlagen, Brunnen und kleinen Gärten. Leider lässt sich die einstige Pracht heute nur mehr erahnen, für Archäologen ist das Gelände dagegen immer noch eine Fundgrube.
Die traurige Geschichte der Maurin und des Christen
Der Mirador de la Odalisca 18, ein Aussichtsfenster in der Nordmauer, ist der lokalen Legende zufolge stummer Zeuge einer tragischen Liebesgeschichte. Eines Tages zu Zeiten Al Mutasims hatten maurische Soldaten einen Christen gefangen genommen. Die Odaliske Galiana, Lieblingssklavin des Herrschers, war von der Schönheit des jungen Mannes so verzaubert, dass sie sich in ihn verliebte und beschloss, zusammen mit ihm zu fliehen. Beim Versuch, sich aus dem Fenster abzuseilen, wurden die beiden jedoch von Wachen entdeckt. Der unglückliche Christ, der lieber starb, als erneut eingekerkert zu werden, stürzte sich aus dem Fenster in den Tod. Galiana wurde einige Tage später tot aufgefunden, gestorben an gebrochenem Herzen.
Man betritt den zweiten Abschnitt durch den Arco gótico 10, errichtet im 16. Jh. und möglicherweise ein Rest des Palastes von Gutiérrez de Cárdenas, des ersten christlichen Herrschers über die Stadt. Vorbei an der Brunnenanlage Aljibes Califales 11 gelangt man zu einer kleinen Kapelle im Mudéjarstil. Der Ziegelbau der Ermita de San Juan 12 soll von den „Katholischen Königen“ gleich nach der Eroberung in Auftrag gegeben worden sein; sehr wahrscheinlich deshalb, dass das Kirchlein demonstrativ auf die Fundamente der früheren Moschee gestellt wurde. Nahe der Kapelle sind die Casas muselmanas 13 zu sehen, zwei maurische Häuser, die Ende der Sechzigerjahre rekonstruiert wurden und wohl als Wohnungen von Bediensteten oder Wachen dienten. Ein Stück nordwestlich, nahe der Mauer, liegen die öffentlichen Bäder Baños públicos 14. Zu einer Zeit, als sich Christenmenschen nur höchst ungern der Unbill unterzogen, sich ausführlich zu waschen, solches Tun später sogar der Inquisition als Verdachtsmoment diente, hatten diese Bäder für die Mauren hohe Bedeutung. Sie dienten nicht nur der Reinigung, sondern auch als Treffpunkt, waren Kommunikationszentrum und wohl auch Ort konspirativer Gespräche. Die hiesigen Badeanlagen stammen aus der Zeit des 13.-15. Jh. und sind nach dem damals üblichen System errichtet: Ein Vorbau diente als Umkleideraum, gefolgt von drei Badehallen. In der ersten Halle wurde kalt gebadet, die zweite und größte besaß lauwarmes Wasser, die dritte und der Heizungsanlage am nächsten gelegene Halle fungierte als Heiß- und Dampfbad.
Der Palacio de Al Mutasim 15 nimmt einen großen Teil des zweiten Bereichs in Anspruch. Die Pracht dieses Palasts, der in der zweiten Hälfte des 11. Jh. dem Taifa-Herrscher Al Mutasim als Residenz diente, wurde von den Zeitgenossen in den höchsten Tönen gepriesen. Leider liegt der Prunkbau heute in Trümmern. Der unübersichtliche, da keineswegs symmetrisch angelegte Grundriss gliedert sich in drei Abschnitte. Im Osten lagen die Wirtschaftsgebäude, die teilweise rekonstruierten Wohnhäuser der Dienerschaft und die Moschee. Weiter westlich gelangt man zum Regierungspalast mit einem gut 30 Meter langen Innenhof, dem Empfangssaal an dessen Nordseite und einem „Königlichen Pavillon“ im Süden. Auf der dem Eingang zum Patio entgegengesetzten Seite bewachten zwei kleine Türme den Eingang zur Mansión privada 16, dem Wohnbereich, der nur dem Herrscher und seiner Familie vorbehalten war. Die sicherlich verschwenderisch dekorierten Privatgemächer gruppierten sich um einen weiteren Innenhof, besaßen eine Zisterne, üppige Gartenanlagen und ein eigenes Badehaus (Baños reales) 17, dessen unterirdisches Dampfheizungssystem noch gut zu erkennen ist.
Dritter Bereich (Tercer Recinto): Der dritte und am höchsten gelegene Abschnitt der Alcazaba entstand erst nach der Einnahme Almerías durch die „Katholischen Könige“. Angesichts der Schäden, die ein Erdbeben von 1487 an der Festung hinterlassen hatte, beauftragten Isabel und Ferdinand ihre Baumeister mit dem Bau einer neuen Verteidigungsanlage. 1492 begannen die Arbeiten, und schon zwei Jahre später sollen sie nahezu beendet gewesen sein. Auffallend ist der Unterschied der maurischen zur christlichen Architektur, die nicht nur die hohe Erdbebengefahr in der Region, sondern auch den zunehmenden Einsatz von Artillerie in der Kriegsführung berücksichtigte. Die Mauern erhielten eine größere Dicke, die Türme wurden in runder statt viereckiger Form errichtet, gestampfter Lehm wich solidem Stein. Das Ergebnis dieser Bauweise war immerhin so dauerhaft, dass dieser Bereich der Alcazaba bis ins die Anfänge des 20. Jh. als Militäranlage genutzt wurde.
Gleich hinter dem Eingang trifft man auf den Platz Patio de Armas 20, der das Zentrum der Verteidigungsanlage bildet; der Silo etwa in seiner Mitte diente einst wohl der Lagerung von Getreide. Rechter Hand steht der Turm Torre del Homenaje 19, das einzige viereckige Exemplar seiner Gattung in diesem Bereich der Festung; am Portal ist ein schon recht verwittertes Wappen der „Katholischen Könige“ zu sehen. Ein Stück weiter birgt der Turm Torre de la Noria del Viento 21 einen über 70 Meter tiefen Brunnen; der Name des Turms lässt darauf schließen, dass das Wasser mittels eines Windrades nach oben geschöpft wurde. Im äußersten Westen der Alcazaba schließlich bietet der „Pulverturm“ Torre de la Pólvora 22 eine bestechende Aussicht über den Hafen und das Chanca-Viertel.
Basis-Infos
Information Oficina de Turismo, Parque Nicolás Salmerón, Ecke Calle Martínez Campos, an der hafennahen Promenade; Tel. 950 175220, [email protected]. Zuständig für die Stadt und ganz Andalusien; freundliches Personal, teilweise sogar deutschsprachig. Mo-Fr 9-19.30 Uhr, Sa/So 9.30-15 Uhr.
Oficina Municipal de Turismo, Plaza Constitución bzw. Plaza Vieja 1, in der Altstadt, Tel. 950 210538. Geöffnet Mo-Fr 9-15 Uhr, Sa/So 10-14 Uhr, im Juli/August Mo-Sa 10-14, 18-20 Uhr, So 10-14 Uhr. www.turismodealmeria.org.
Verbindungen Flug: Flughafen (Tel. 913 211000, www.aena.es) etwa acht Kilometer östlich der Stadt, nahe der AL 12 Richtung Níjar; häufige Busverbindung mit der Surbus-Linie L30 zum Busbahnhof.
Bahn: Bahnhof