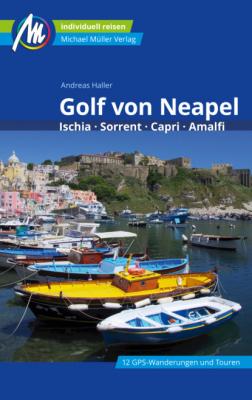ТОП просматриваемых книг сайта:
Golf von Neapel Reiseführer Michael Müller Verlag. Andreas Haller
Читать онлайн.Название Golf von Neapel Reiseführer Michael Müller Verlag
Год выпуска 0
isbn 9783956548581
Автор произведения Andreas Haller
Жанр Книги о Путешествиях
Серия MM-Reiseführer
Издательство Bookwire
Cappella Sansevero
Die Privatkapelle der Adelsfamilie Sansevero ist von außen unscheinbar, birgt aber ein bemerkenswertes Kunstwerk, das man sich nicht entgehen lassen darf. Es handelt sich um die Statue des Verhüllten Leichnam Christi (Cristo velato), die der neapolitanische Meister Giuseppe Sanmartino 1753 schuf. Von atemberaubender Anmut ist das Leinentuch aus Marmor, das auf die Betrachter der „Pietella“ wie ein transparentes Tuch wirkt, obwohl es in Wahrheit aus einem Stück mit dem Rest der Statue angefertigt wurde. Es handelt sich in der Tat um ein kolossales Meisterwerk der Barockkunst! Zudem beherbergt das Kirchlein zwei anatomische Modelle, die ein wenig an Gunther von Hagens und seine platinierten menschlichen Körper erinnern. Die „Skulpturen“ − es handelt sich um einen Mann und eine schwangere Frau − entstanden ebenfalls im 18. Jh. Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben 2008 die Echtheit der Skelette, das Netz der Blutgefäße hingegen ist künstlich und besteht aus Draht und farbigem Wachs. Die an ein Wunderkabinett gemahnenden Ausstattungsstücke gaben immer wieder zu Spekulationen Anlass, zumal der damalige Eigentümer der Privatkapelle Freimaurer war, dem man beste Beziehungen zur alchimistischen Szene nachsagte (→ Kasten, siehe unten).
♦ Tägl. außer Di 9−19 Uhr. 8 €, erm. 6 €. Via Francesco De Sanctis 19−21, www.museosansevero.it.
Freimaurer, Erfinder, Alchimist: Raimondo, Fürst von Sansevero
Raimondo di Sangrio (1710−1771), Fürst von Sansevero, war eine schillernde Figur im barocken Neapel. Der Soldat in Diensten der Bourbonen erhielt in Rom eine fundierte Jesuitenausbildung, bevor er sich in Neapel niederließ und in der Hauptsache wissenschaftliche Forschungen betrieb. Zahlreiche Freimaurersymbole in der Privatkapelle der Familie Sansevero (→ siehe oben) lassen vermuten, dass Raimondo Mitglied in den Geheimbünden der Freimaurer und Rosenkreuzer war. Im Lauf der Zeit stieg er sogar bis zum Logenmeister auf. Vielen Zeitgenossen, v. a. den Vertretern der Kirche, war das Treiben des Adeligen jedoch überaus suspekt. Den Gipfel der Absonderlichkeiten markierten die Skelette, die noch heute in der Kapelle ausgestellt sind. Hinter vorgehaltener Hand wurde gemunkelt, Raimondo habe lebenden Menschen eine Art alchimistisches Zauberserum injiziert, um das augenblickliche Erstarren des Gefäßapparates zu erwirken. Tatsächlich kaufte er eins dieser Modelle der menschlichen Anatomie einem Arzt aus Sizilien namens Giuseppe Salerno ab, nachdem er es auf einer öffentlichen Ausstellung entdeckt hatte. Das zweite Modell, die schwangere Frau, gab er danach bei dem Arzt in Auftrag.
Sant’Angelo a Nilo
Die Stiftskirche wäre eventuell kaum eines Blickes wert, wenn sich innen nicht ein ganz besonderes kunsthistorisches Kleinod befände. Es handelt sich um das Grabmal des Kardinals Brancaccio, weswegen das Gotteshaus auch als Cappella Brancaccio bekannt ist. Die sechs Skulpturen − fünf stehend, eine liegend − schufen mit Donatello und Michelozzo zwei bedeutende Renaissancebildhauer. Bemerkenswert sind die Faltenwürfe der Gewänder!
♦ Mo−Sa 8.30−13 und 16.30−18.30, So 8.30−13 Uhr. Eintritt frei.
San Domenico Maggiore
Karg wirkt die Fassade der Dominikanerkirche von außen, innen überwältigt üppiger Barock. Die prächtige Ausstattung erzeugt einen stimmigen Gesamteindruck und verhehlt dabei nicht, dass es sich ursprünglich um ein gotisches Bauwerk handelte. Übrigens studierte 1239−1244 Thomas von Aquin am Studium Generale der Universität von Neapel; der Dominikaner sollte in der Folge zu einem der bedeutendsten Kirchenlehrer des Mittelalters werden. Seltsamerweise führt vom Vorplatz am Spaccanapoli eine Treppe hinauf und in die Kirche, wobei man das Gotteshaus durch eine Türe direkt am Hauptaltar betritt! Im Kloster nebenan werden die Kirchenschätze ausgestellt, die sich bei einer Führung begutachten lassen.
♦ Kirche: Tägl. 10−19 Uhr. Eintritt frei. Kloster und Museum: Tägl. 10−18 Uhr. Führungen 5 €, erm. 4 € (kompakt), 7 €, erm. 5 € (ausführlich). Piazza San Domenico Maggiore 8a, www.museosandomenicomaggiore.it.
Santa Chiara
Der ehemalige Klarissinnenkonvent zählt zu den Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt. Die Fenster der riesigen Kirche im Zentrum des Klosterkomplexes lassen nur wenig Licht hinein, und auch sonst wirkt das hoch aufragende gotische Längsschiff auf den ersten Blick etwas karg. Eigenartigerweise verzichtet der Sakralbau auf Querhaus und Chor, was konzeptionelle Gründe hat: Der benachbarte Klarissinnenkonvent musste nämlich integriert werden, ein Problem, das die Architekten im 14. Jh. mit einem komplett vom Innenraum abgetrennten Nonnenchor lösten. Das Längsschiff wird auf beiden Seiten von Kapellen flankiert, die u. a. als Grabkapellen neapolitanischer Herrscher fungierten. Das kunsthistorisch bedeutendste Grabmal befindet sich hingegen am Hochaltar. Hier ruhen die sterblichen Reste Roberts von Anjou, Mitte des 14. Jh. schufen die florentinischen Künstler Giovanni und Pacio Bertini das Monumentalgrab. Ein Bombenangriff am 4. August 1943 richtete schwere Zerstörungen in der Kirche an.
Sehenswert ist auch der Kreuzgang südlich der Kirche. Einzigartig sind die Säulen, Balustraden und Sitzbänke, die mit farbigen Majolikaplatten gefliest sind. Der spielerisch-leichte Gesamteindruck will so gar nicht zur monastischen Strenge passen, schließlich leben heute noch immer einige franziskanische Minderbrüder in dem Kloster. Den Majolikakreuzgang schuf 1739 der bedeutende neapolitanische Maler und Rokokobildhauer Domenico Antonio Vaccaro. Den Umbau der mittelalterlichen Klosteranlage im Stil des Barock sponserte u. a. die Königin Maria Amalia von Sachsen, Frau des Bourbonenkönigs Karl III., mit nicht geringen finanziellen Mitteln. Vom Seitenflügel des Kreuzganges ist ein übersichtliches, aber sehenswertes Museum zugänglich (Museo dell’Opera): Die gezeigten Exponate illustrieren Aspekte der Baugeschichte und stammen aus unterschiedlichen Epochen von der Gotik bis zum Barockzeitalter. Außerdem sind vom Museum die freigelegten Reste einer Therme aus römischer Zeit zugänglich. Es handelt sich um die größte bislang entdeckte Thermenanlage im Stadtgebiet; die wichtigsten Funde aus dem Grabungsareal werden ebenfalls nebenan im Museum präsentiert.
♦ Kirche: 7.30-13 und 16.30-20 Uhr. Kloster: Mo−Sa 9.30−17.30, So 10−14.30 Uhr. 6 €, erm. 4,50 €. Via Santa Chiara 49c, www.monasterodisantachiara.it.
Oase der Ruhe: Der Majolika-Kreuzgang von Santa Chiara
Chiesa Gesù Nuovo
Von außen ist dieses Gotteshaus aus gutem Grund nicht als ein solches erkennbar: Denn ursprünglich befand sich hinter der Diamantquaderfassade mit den Pyramidenspitzen aus Stein der Palazzo der Adelsfamilie Sanseverino. Im Zeitalter der Renaissance entwickelte sich der Palast zu einem der bedeutendsten kulturellen Zentren der Stadt. Nach der gescheiterten