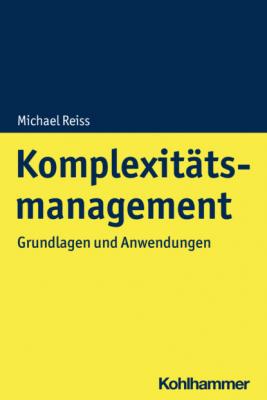ТОП просматриваемых книг сайта:
Komplexitätsmanagement. Michael Reiss
Читать онлайн.Название Komplexitätsmanagement
Год выпуска 0
isbn 9783170355958
Автор произведения Michael Reiss
Жанр Зарубежная деловая литература
Издательство Bookwire
Eine sehr verbreitete komplexitätsfokussierte Modellierung des Umsystems von Unternehmen arbeitet mit den Komplexitätsmerkmalen »dynamisch (turbulent) versus stationär« oder »transparent versus intransparent«. Die inhaltliche Modellierung basiert demgegenüber auf den sogenannten PESTEL-Domänen, also spezifische Wettbewerber, Gesetze oder Technologien. In ähnlicher Weise lassen sich Netzwerke komplexitätsfokussiert anhand der Vielzahl und Vielfalt von Knoten und Kanten charakterisieren, wobei direkte und indirekte Beziehungen bzw. formelle (transparente) und informelle (intransparente) Beziehungen unterschieden werden (Easley/ Kleinberg 2010). Im Rahmen einer inhaltlichen Modellierung geht es demgegenüber etwa um die Beschaffenheit der jeweiligen Beziehungen (z. B. Kommunikation, Transaktionen, Likes, Sympathie, Verwandtschaft) und der Knoten. Sie erlauben eine Unterscheidung zwischen Personennetzwerken (z. B. Familien, Vereine, Berufsverbände), Unternehmensnetzwerken (z. B. Franchise-Systeme, Kartelle), Verkehrsnetzen, Computer-Netzwerken und dem Internet. Organisierte Wettbewerbe lassen sich durch die Komplexitätsbrille formal anhand der Selektionsmechanismen (z. B. Rating durch eine Jury oder Gruppenphase und KO-Phase im Mannschaftssport), material hingegen anhand des besseren oder schlechteren Abschneidens der involvierten Akteure charakterisieren.
Wie erfolgreich das Arbeiten mit einem Plan B ist, hängt einerseits vom Inhalt des Plans ab. Aus der Komplexitätsperspektive geht es hingegen darum, dass man über zwei alternative Handlungsoptionen verfügt. Analog unterscheiden sich organisatorische »Zelte« (z. B. Projektteams) und »Paläste« (z. B. Abteilungen) durch ihre Aufgabenbeschreibung. Aus der Komplexitätssicht besteht der Unterschied eher in ihrer unterschiedlichen Einrichtungsdauer. Die inhaltliche Differenzierung zwischen Impfstoffen basiert auf den jeweiligen Rezepturen. Komplexitätsfokussiert steht etwa die trivalente oder die tetravalente Zusammensetzung im Vordergrund.
Allerdings ist zu beachten, dass es Überschneidungen zwischen inhaltlicher und komplexitätsfokussierter Modellierung gibt. Verantwortlich dafür zeichnet nicht zuletzt die implizite Komplexität von inhaltlich spezifizierten Konstrukten. So haben beispielsweise Preise eine implizite Komplexität, weil sie als Knappheitsindikatoren fungieren, d. h. die Relation zwischen den beiden Komplexitätsmerkmalen »Nachfragemenge« und »Angebotsmenge« erfassen. Auch mehrere Erscheinungsformen der sogenannten »Syndrome des globalen Wandels« weisen ein hohes Maß an impliziter Komplexität auf. Das gilt beispielsweise für das Dust Bowl-Syndrom (dominante Symptome: Bodendegradation und Wasserkontamination) im Gefolge einer industrialisierten Landwirtschaft, die u. a. durch die Komplexitätsmerkmale »Monokulturen« und »hochintensiver Einsatz von Düngemitteln und Bewässerung« geprägt ist. Auch das Bricolage-Konzept, also die Entwicklung von Problemlösungen ausschließlich mit vorhandenen Ressourcen, ist insofern implizit komplexitätsfokussiert, als es einen sparsamen Umgang mit Ressourcen beinhaltet (Duymedjian/ Rüling 2010). Analog besitzen inhaltlich spezifizierte Bedrohungen wie z. B. ein »aggressives« Wettbewerberverhalten eine implizite Komplexität in Form von Größenasymmetrie, Überraschung, sogenannten Credible Threats oder transparenzmindernden Aktivitäten: Hierzu zählt etwa ein desinformierendes Signaling des Wettbewerbers in Gestalt einer Ankündigung von Patentanmeldungen, die tatsächlich nicht stattfinden. Begrifflichkeiten wie »Gratwanderung« oder »Drahtseilakt« besitzen insofern eine implizite Komplexität, als sie die Abwesenheit von (komplexitätsminderndem) Spielraum und von Fehlertoleranz zum Ausdruck bringen. Bei zahlreichen inhaltlichen Konstrukten wie z. B. Intelligenz, Macht, Betriebsklima oder Infrastruktur besteht die Komplexität in deren Mehrdimensionalität.
Zwischen inhaltlicher und komplexitätsfokussierter Modellierung existieren nicht nur Überschneidungen, sondern auch gestaltete Kombinationsformen. Sie folgen entweder einem sukzessiven oder einem simultanen Kombinationsmuster. Die sukzessive Kombination vollzieht sich über Prozesse der Abstraktion und Konkretisierung mit den drei Etappen (1) inhaltsfokussiertes Ausgangsmodell, (2) komplexitätsfokussiertes Modell (via Abstraktion) und (3) inhaltsfokussiertes Modell (via Konkretisierung). Beispielhaft lässt sich die sukzessive Kombination anhand der Transaktionskostentheorie illustrieren (Williamson 1979; Ebers/ Gotsch 2014). Die komplexitätsfokussierte Abstraktion von Transaktionen, gleichgültig also ob es sich inhaltlich um »Ware gegen Geld«, »Ware gegen Ware«, um Finanztransaktionen bzw. um legale oder illegale Transaktionen handelt, erfolgt in der Transaktionskostentheorie anhand von Komplexitätsmerkmalen wie Spezifität, Häufigkeit, Unsicherheit und Instabilität (Reiss 2013, S. 140). Anschließend erfolgt eine inhaltliche Charakterisierung der Transaktion, meist anhand der verursachten Transaktionskosten. Analog wird »Krise« komplexitätsfokussiert anhand von Wende, Überraschung und Instabilität charakterisiert. Inhaltlich wird Krise hingegen durch die existenzgefährdenden Wirkungen konkretisiert. Auch das Konzept der kritischen Werte (z. B. Gewinnschwellen, Preisgrenzen oder Wachstumsschwellen) veranschaulicht eine Facette der sukzessiven inhalts- und komplexitätsfokussierten Modellierung: Dabei fungieren vorgegebene inhaltliche Zielvariablen als Orientierungsrahmen für die Bestimmung von komplexitätsfokussierten kritischen Werten, etwa Gewinnschwellen. Wie aus der Break Even-Analyse bekannt, handelt es sich bei kritischen Werten um Komplexitätsmerkmale, z. B. Mengen, aber auch Abweichungen, Schäden (z. B. im Rahmen der FMECA: Failure Modes, Effects and Criticality Analysis) oder Wachstumsraten. Ihre jeweilige kritische Ausprägung wird durch inhaltliche Zielgrößen bestimmt, bei der Break Even-Analyse durch Umsätze und Kosten.
Die sequenzielle Einbettung in die inhaltliche Modellierung verdeutlicht einerseits, dass Komplexitätsorientierung keinen Selbstzweck darstellt, sondern nur ein Hilfsmittel in Gestalt einer »heuristischen Vorsteuerungsphase«. Zugleich wird deutlich, dass es sich bei der komplexitätsfokussierten Modellierung um einen Umweg handelt. Diese offensichtliche Komplexitätssteigerung wirft die Frage nach dem heuristischen Wert eines solchen Umwegs auf. Sie stellt sich ähnlich auch bei anderen zwischengestalteten Abstraktionsprozessen, etwa beim Data Mining, Text Mining und Visual Mining oder bei Verfahren zur Mustererkennung in Zeitreihen. Der Nutzen besteht vornehmlich in der verbesserten Identifikation von generischen Erklärungsfaktoren bzw. Erfolgsdeterminanten. Es handelt sich ähnlich wie im Systemansatz um standardisierte, generische Merkmale. Für die wirkungsorientierte Bewertung dieser Merkmale liegen also zahlreiche Evidenzen und Erfahrungswerte vor. So zeichnet sich beispielsweise die Sharing-Economy durch generische Komplexitätsmerkmale wie höheren Nutzungsgrad von Ressourcen, reduzierten Ressourcenverbrauch oder die mehrdeutige Zurechnung von Kosten auf die individuellen Nutzer in einer Sharing-Community aus. Sie müssen inhaltlich konkretisiert werden, je nachdem ob es sich um ein Car Sharing, eine sogenannte Fractional Ownership (Eigentum an selten genutzten teuren Assets), einen Maschinenring (z. B. Landmaschinen) oder ein Wissens-Sharing in Wissens-Communities bzw. im Peer-Coaching handelt.
Ein zweites Kombinationsmuster zwischen inhaltsfokussierter und komplexitätsfokussierter Modellierung ist die Simultan- oder Parallelkombination. Hierbei erfolgt parallel eine sich ergänzende Modellierung anhand formaler und inhaltlicher Bausteine. Werden beispielsweise in einem Erklärungsmodell nebeneinander komplexitätsfokussierte und inhaltsfokussierte Ursachen oder Wirkungen herangezogen, liegt eine gemischte Gesamtmodellierung vor: So wird zum Beispiel der Arbeitswert in der Arbeitsbewertung anhand von inhaltlichen Anforderungen und von komplexitätsfokussierten Anforderungen wie z. B. der Neuartigkeit der Aufgaben ermittelt. Nach derselben Logik lassen sich Umsatzeinbußen z. B. parallel durch inhaltsfokussierte Qualitätsprobleme und durch eine komplexitätsfokussierte Volatilität der Nachfrage erklären. Ist beispielsweise von »volatilen Aktienkursen« die Rede, fungiert Komplexität als zusätzliche formale Spezifikation. Modellansätze wie Leadership 4.0 oder Arbeitswelt 4.0 bezeichnen eine inhaltliche Domäne und bringen zugleich den dort stattfindenden komplexitätssteigernden Wandel zum Ausdruck. »Fixkosten« spezifizieren zugleich ein inhaltlich bestimmtes Kostenniveau und zusätzlich komplexitätsfokussiert ein komplexes, weil untypisches Kostenverhalten. Das Komplexitätsattribut »unecht« in »unechte Gemeinkosten« weist darauf hin, dass es sich tatsächlich um Einzelkosten handelt. Manchmal werden inhaltsfokussierte und komplexitätsfokussierte Charakterisierungen als