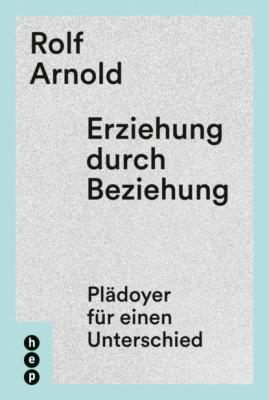ТОП просматриваемых книг сайта:
Erziehung durch Beziehung. Rolf Arnold
Читать онлайн.Название Erziehung durch Beziehung
Год выпуска 0
isbn 9783035506907
Автор произведения Rolf Arnold
Жанр Документальная литература
Издательство Bookwire
Diese Äußerung erntete nicht bloß Zustimmung, sondern auch Widerspruch, wie: »Wo kommen wir denn da hin, wenn man sich zurückhalten soll!« oder »Das genau ist doch das Problem, dass viele Eltern sich gar nicht mehr trauen, zu sagen, was geht und was nicht!« Solche Entgegnungen sind zu erwarten. Wir sind, indem wir in dieser Form emotional oder gar wütend reagieren, nicht bei der Frage, wie sich komplizierte Erziehungsfragen wirksam lösen lassen. Sind wir doch mal ehrlich: Wir wissen doch, zu welchen Reaktionen wütende Klarstellungen beim Gegenüber führen. Dieses fühlt sich im vertrauten Film und reagiert genauso, wie wir es gerade verändern möchten: durch innerliche Distanzierung, Sich-unverstanden-Fühlen und Abwendung. Nicht selten fühlen wir uns eine kurze Zeit lang gut, weil wir für Klarheit gesorgt haben, müssen aber enttäuscht beobachten, wie uns unser Kind, die Schülerin oder der Schüler, für die wir verantwortlich sind, mehr und mehr entgleiten. Ungewollt und in bester Absicht haben wir wieder einmal gegen eine weitere Lektion einer wirksamen Erziehungspraxis verstoßen, die da lautet:
Handeln Sie stets so, dass Sie die Beziehung zum Kind oder der bzw. dem Jugendlichen aktiv aufrechterhalten. Lernen Sie und üben Sie dafür Ihre Erziehungs-Sprachkompetenz!
Doch was bedeutet es, als Erziehungsverantwortlicher aktiv die Beziehung aufrechtzuerhalten? Wissen und berücksichtigen wir in unserer Erziehung die Tatsache, dass eine enge Beziehung nur in der Begegnung möglich ist? Begegnen wir den Kindern und Jugendlichen, für die wir Verantwortung tragen, tatsächlich? Greifen wir dabei zu den angemessenen Formen? Oder reden wir einfach so drauf los:
•ermahnend, weil uns danach ist,
•belehrend, weil wir sicher zu wissen glauben, was unsere Kinder benötigen,
•kontrollierend verhörend, weil wir misstrauisch sind,
•laut schimpfend, weil wir glauben, so besser Gehör zu finden, oder
•verständnisvoll nachfragend, weil wir ein echtes Interesse an den Gefühlen und Gedanken unseres Gegenübers haben?
Nur im letzten Fall wächst die Chance, dass wir die Kinder und Jugendlichen tatsächlich erreichen. Keine Wirkung haben wir, wenn diese rasch bemerken, dass wir sie wieder einmal durch die Defizitbrille beobachten. Dabei blicken wir meist durch unsere Erfahrungen auf ihr Verhalten und interpretieren dieses unmittelbar, d. h., bevor wir es verstanden haben. Wir reden dann von »schwierigen Schülern oder Schülerinnen«, von »Ungezogenheit« oder »Auffälligkeit« und zeigen bereits durch diese Wortwahl, dass wir sicher zu wissen meinen, was los ist. Dabei arbeiten wir aber lediglich mit unseren eigenen inneren Bildern, die nicht deshalb richtig sind, weil wir sie haben. Mit diesen legen wir unsere Kinder fest und verlieren allmählich den Kontakt zu ihnen.
Konrad – ein nachdenklicher Vater – berichtete:
»Irgendwie hat sich das mit meinem Sohn nicht gut entwickelt. Manchmal meine ich, wir hatten einen schlechten Start, und ich wünsche mir eine Art Reset-Taste. Alles begann mit meiner Erschöpfung: Wenn ich abends nach Hause kam, drehte mein Sohn erst richtig auf und versuchte mit allen möglichen Aktionen, mich in Trab zu halten. Irgendwie nervte mich dies enorm, und ich ermahnte und strafte ihn, wo es doch nur darum gegangen wäre, Klarheit herzustellen – vor allem Klarheit in meinem eigenen Kopf. Da ich dies nicht konnte, reagierte ich einfach so, wie ich mich fühlte – mit dem Erfolg, dass mein Sohn mir nur als Störenfried begegnete.«
Um solche Entfremdungen zu vermeiden, ist es hilfreich, sich die unterschiedlichen Stufen der erzieherischen Beziehungsarbeit klar vor Augen zu führen und die Erziehungssprache zu üben.
Die »Treppe der Beziehungssprachen« zeigt:
•Es gibt drei Arten des erzieherischen Sprechens: die Sprache der Zuwendung, den Dialog und die Sprache der Konfrontation.
•Erziehung kann nur wirksam werden, wenn Klärung gelingt, nicht wenn ohne Resonanz aneinander vorbeigeredet wird.
•Meist ist es sinnvoll, zunächst über die Sprache der Zuwendung einen Kontakt zum Gegenüber herzustellen und über das Trösten und Nachfragen seine Sicht der Dinge zum Ausdruck kommen zu lassen, ohne sogleich von der fünften Stufe herunterzustürmen.
•Grenzen müssen erklärt werden. Dabei sind Ich-Botschaften hilfreich, mit denen man dem Kind mitteilt, wie es um einen steht bzw. welche Folgen sein Verhalten für einen selbst hat.
Nachdem Konrad die fünf Arten des erzieherischen Sprechens kennengelernt hatte, stellte er betroffen fest:
»Ich habe meinen Jungen nicht abgeholt, sondern ihn gleich mit meinen Grenzen konfrontiert – im wahrsten Sinne des Wortes ›von oben herab‹, und noch nicht einmal das habe ich richtig gemacht. Dadurch habe ich ihn zurückgewiesen. Heute weiß ich, dass sein Verhalten nicht schwierig, sondern verständlich gewesen ist. Er wollte mit mir zusammen sein. Ich hätte ihn zunächst trösten können, ihm aber auch gleich mitteilen können, dass ich ein Problem habe, wenn ich müde nach Hause komme und mich zunächst einmal nicht auspendeln kann. Dann hätte ich eine Art Absprache mit ihm erzielen können, dass ich z. B. nach einer Stunde mit ihm spielen würde – ganz ohne Vorwurf oder in einer Form, in der ich meine Erschöpfung einfach so nach außen lasse. Mir ist nun klar: Die meisten Erziehungsprobleme sind solche des unangemessenen Sprechens. Da begrenzen wir, wo Trösten ansteht, oder wir erklären, wo Nachfragen anstünden – alles ein Riesendurcheinander. Und warum? In meinem Fall ist es so, dass ich selbst weder die Sprache der Zuwendung noch die Form des Dialogs wirklich beherrsche. Glücklicherweise ist mir dies aufgefallen, und ich frage mich heute immer:
•Wer hat eigentlich das Problem? In meinem Fall hatte ich das Problem, weshalb Erklärung anstand.
•Worum geht es meinem Sohn? Da schaffe ich Zeiten, in denen ich ganz achtsam zuhöre, ihn reden lasse und nachfrage.
•Was muss geklärt werden? Da ist es für mich durchaus eine neue Erfahrung, dass ich nicht immer als der große Klärer und Erklärer gefragt bin, vielmehr kann sich mein Sohn selbst erklären. Er lernt und übt so, seine eigene Rolle als Gegenüber in der Kommunikation wirklich zu spielen, ohne nur auf das zu reagieren, was ich ihm erlaube.«
In den Erziehungsdebatten geht es um Werte und Werterziehung: Eltern sehen sich mit dem Anspruch konfrontiert, ihre Kinder zu wertebewussten Menschen zu erziehen. Als wertebewusst wird dabei angesehen, wenn Kinder und Jugendliche sich nicht allein von ihren eigenen Interessen leiten lassen, sondern auch in der Lage sind, ihr Verhalten an den überlieferten – humanen – Vorstellungen und Erwartungen der Gesellschaft zu orientieren.
An Formulierungen solcher Werte herrscht kein Mangel. Immer wieder drängen sie sich als Vorwurf in die aktuellen Debatten. Dann ist zu vernehmen, Lehrpersonen hätten keine Werte mehr, auf die sie achten. Auch Eltern sehen sich immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, ihren Kindern zu lasch und verantwortungslos gegenüberzutreten. Wie dem auch immer sei, wichtige Fragen sind:
•Welche Werte sind es wert, unsere Erziehung an ihnen zu orientieren?
•Wie gelingt eine Wertevermittlung?
Das Wertespektrum
Was unsere Gesellschaft von Kindern und Jugendlichen erwartet, war über viele Jahrzehnte unumstritten: Ordnung und Disziplin – diese beiden sogenannten deutschen oder preußischen Tugenden rangieren nicht nur im Kaiserreich, sondern auch in den dunkleren Zeiten der Geschichte an oberster Stelle. Von Elternhaus und Schule wird erwartet, dass die Nachwachsenden an diese Anforderungen angepasst werden – mit