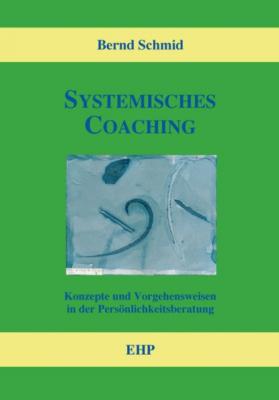ТОП просматриваемых книг сайта:
Systemisches Coaching. Bernd Schmid
Читать онлайн.Название Systemisches Coaching
Год выпуска 0
isbn 9783897975224
Автор произведения Bernd Schmid
Жанр Социология
Издательство Bookwire
Um Zwickmühlen zu vermeiden oder zu entdecken, ist es wichtig, in Therapiesituationen eigene Reaktionen aus dem Dilemmazirkel zu entdecken und ernst zu nehmen; ebenso näher hinzusehen, wenn man selbst kein stimmiges Bild vom Problem des Klienten und vom Prozess, über den das Problem inszeniert wird, formen kann. Erhöhte Aufmerksamkeit ist geboten, wenn man den Bezugsrahmen des Klienten nicht formulieren kann und sich aus der Gegenüberstellung mit dem Bezugsrahmen des Therapeuten keine Antithese im Inhalt wie im Prozess formulieren lässt. Wiederholte Äußerungen des Klienten, dass er sich nicht richtig verstanden fühlt, oder dass eine Lösung für ihn unmöglich oder unannehmbar ist, sollten ebenfalls ernst genommen werden. Eigene Reaktionen auf Zwickmühlen-Angebote in Therapiesituationen sollten, wenn möglich, nicht agiert, sondern für die soziale Diagnose (Analyse der Gegenübertragung) benutzt werden.
Wie fragt man nach Zwickmühlen? Hauptsächlich durch Fragen, die nach der Übersetzung von Sprachwendungen in konkrete Situationen oder nach der Bedeutung von konkreten Situationen für den Klienten fragen, nach Zusammenhängen zwischen Ereignissen und dem Bezugsrahmen des Klienten. Beispiele: Wie ist das geschilderte Ereignis ein Problem? – Was würde die Option für dich bedeuten? – Was würde geschehen, wenn du die dir unannehmbare Lösung ausprobieren würdest? – Was würde es für dich bedeuten, wenn …? – Dies ist geschehen, weil …? – Was geschieht, wenn …? – Was geschieht, wenn nicht …? – Wie erklärst du dir, dass …?
4.7 Therapeutischer Umgang mit der Dilemmadynamik
Oft zeigt es sich, dass ein Kind in einer Zwickmühlen-Situation die Schlussfolgerung zieht: »Es ist durch meine Schuld zu der Schwierigkeit gekommen und es ist mein Fehler, dass ich die Situation nicht lösen kann.« Das heißt, das Kind übernimmt eine falsche Definition der Situation und ihrer Ursachen, ebenso die Idee, für eine Lösung der für das Kind unlösbaren Situation verantwortlich zu sein. Die Konfrontation eines Klienten, der im kindlichen Erleben eine solche Zwickmühle konstelliert und im Transaktionsprozess abbildet, ist schwierig. Sagt der Therapeut diesem Klienten, dass er heute anders handeln kann und für sein jetziges Verhalten Verantwortung übernehmen soll, hört der Klient (auf die kindliche Zwickmühlen-Situation bezogen): »Du bist schuld. Du muss das Problem lösen.« Der Klient wird die Verantwortung für die heutige Zwickmühlen-Situation ablehnen, weil er seine heutige Verantwortlichkeit mit der ursprünglich übernommenen Verantwortung für eine fremdgestaltete Zwickmühle verwechselt.
Dabei kann man sich folgende Dynamik im kindlichen Erleben des Klienten vorstellen: »Als erstes möchte ich Anerkennung und Bestätigung dafür, dass es nicht mein Fehler war, und ich möchte, dass meine Verzweiflung verstanden und als berechtigt anerkannt wird. Wenn ich Verantwortung übernehme, heißt das, es war und ist mein Fehler. Sage ich aber, es ist nicht mein Fehler, und die anderen sollen die Situation klären oder für mich lösen, werden mir die gleichen Vorwürfe gemacht, die ich selbst schon lange erlebe, aber als unberechtigt empfinde.«
Als therapeutische Haltung ist es hier wichtig, sich nicht in der Zwickmühlen-Konstellation fangen zu lassen, aber zugewandt und interessiert zu bleiben, auch wenn die Situation unklar ist. Der Klient inszeniert ja gerade deshalb eine Zwickmühlen-Situation, weil er hofft, dass diesmal eine Lösung möglich wird. Um positiv reagieren zu können, ist es für den Therapeuten sehr nützlich, zwischen der Ebene des kindlichen Erlebens und der heutigen Inszenierung der Zwickmühlen-Konstellation durch den Erwachsenen zu unterscheiden. Dementsprechend ist es hilfreich, diese beiden Persönlichkeitsanteile im anderen getrennt anzusprechen.
Zum Kind kann man sinngemäß Folgendes sagen: »Es ist möglich, dass du dich in einer Zwickmühle gefangen fühlst und darüber verzweifelt bist. Und ich glaube, dass du zu Recht verzweifelt bist über die Art und Weise, wie du die Situation erlebst. Ich kann gut verstehen, dass es dein Wunsch ist, dass jemand anderes dir hilft, deine Situation besser zu verstehen und so zu definieren, dass du dich gut fühlen und etwas Sinnvolles tun kannst. Du brauchst nicht länger zu kämpfen. Es gibt eine Lösung für dein Problem, aber sie sieht anders aus, als du bisher angenommen hast. Es ist nicht dein Fehler, dass du keine Lösung gefunden hast. Es war nicht deine Schuld.«
Dadurch stelle ich mich als Therapeut auf die Seite des verzweifelten Kindes und zeige dem Klienten so Verständnis für seine Lage, ohne seinen Bezugsrahmen zu teilen. Ich gebe ihm Schutz und Erlaubnis. Häufig fließen hier die ersten Tränen, und der Klient kann im Erleben aus der Dilemmadynamik aussteigen und erinnert Kindheitssituationen, die mit dieser Beschreibung angesprochen wurden.
Dem Erwachsenen sagen wir getrennt davon sinngemäß etwa Folgendes: »Heute ist die Situation anders als früher. Ich verstehe, dass du Situationen und Erleben in Szene setzt, die deinem früheren Erleben ähnlich sind, da das Bedürfnis, in solchen Situationen Lösungen zu erfahren, noch unbefriedigt geblieben ist. Heute allerdings bist du es, der diese Situationen hervorruft. Dafür kannst du auch heute Verantwortung übernehmen, was den Vorteil hat, dass du, mit unserer Hilfe, herausfinden kannst, wie du dich in verzweifelte Situationen bringst, und wie du stattdessen befriedigende Lösungen finden kannst.« Dann wieder zum Kind: »Das heißt aber nicht, dass es damals dein Fehler war.«
So wechseln wir zwischen dem Kind und dem Erwachsenen hin und her. Den Erwachsenen laden wir zum Denken und zum Verstehen ein und zeigen auf, dass die Fortsetzung des Leidens in der bisherigen Weise keinen Sinn hat. Dem Kind zeigen wir Verständnis für sein bisheriges Leiden und erkennen die bisherigen Anstrengungen an, auch wenn sie vom Erwachsenenstandpunkt aus nicht sinnvoll waren. Gleichzeitig vermitteln wir dem Kind Hoffnung. Durch dieses Vorgehen erfährt der Klient in seinem kindlichen Erleben Erleichterung, kommt eher in Kontakt mit ursprünglichen Gefühlen und ist eher bereit, auf erwachsene Weise mitzuarbeiten, um die Logik und die Dynamik der inszenierten Zwickmühlen aufzudecken, um Alternativen zu entwickeln und zu realisieren.
Soweit möglich, kann der Therapeut von der Definition, dass eine Zwickmühle besteht, ausgehend formulieren, wie er sich die Zwickmühle, in der das Kind damals gewesen sein muss, vorstellt. Hier helfen die Interpretation der beobachteten Dynamik und Intuition. Gleichfalls könnte er oder die Gruppe für das heutige Zwickmühlen-Erleben und den zugrundeliegenden Bezugsrahmen Ideen entwickeln. Damit wird dem Anliegen des Kindes, dass »die anderen« sich des Problems annehmen, entsprochen, aber auf konstruktive Weise.
Selbst wenn die Formulierungen zunächst allgemein oder ungenau sind, fühlt sich der Klient oft dennoch verstanden, wenn der Zwickmühlen-Charakter der Beschreibung deutlich wird. Er begreift intuitiv, dass er verstanden wird und sich hier eine Lösung anbahnt. Dementsprechend trägt er zunehmend zu treffenderen Analysen bei. Im Wechselspiel mit der inhaltlichen Analyse der jeweiligen Zwickmühle kann die allgemeine Zwickmühlen-Dynamik mit ihren oben beschriebenen typischen Verwechslungen aufgezeigt und der Bezugsrahmen des Klienten so re-definiert werden, dass die Zusammenhänge funktional werden.
Lernt der Klient Zwickmühlen-Probleme anzugehen, ohne sich im Agieren der Zwickmühlen-Dynamik zu verzehren, ist der Zwickmühlen-Zirkel dauerhaft unterbrochen.
4.8 Der Gebrauch von Bildern und Metaphern
Da Klienten, solange sie im Dilemmazirkel gefangen sind, für Erklärungen an das Erwachsenen-Bewusstsein wenig aufnahmebereit sind, helfen Metaphern, sie in ihrem Erleben anzusprechen und Interesse zu wecken.
Wir erzählen z.B. die Geschichte eines japanischen Soldaten, der 30 Jahre nach Kriegsende im Dschungel gefunden wurde und immer noch glaubte, es sei Krieg. Einmal war es für diesen Soldaten sicher schwierig zu glauben, dass der Krieg längst vorbei war, und zu akzeptieren, dass die Welt, in der er subjektiv gelebt hat, sich von der Welt draußen völlig unterschied. Allein zu ertragen, so lange unnötigerweise im Kriegszustand gelebt zu haben, stellt eine erhebliche Belastung dar. Um wieder in der anderen Welt teilzunehmen, kann der Soldat nicht mehr seinen alten Lebensgewohnheiten folgen. So vieles, was er in seinen persönlichen, langen Kriegsjahren an Entwicklung der Welt draußen nicht miterlebt hat, muss jetzt neu