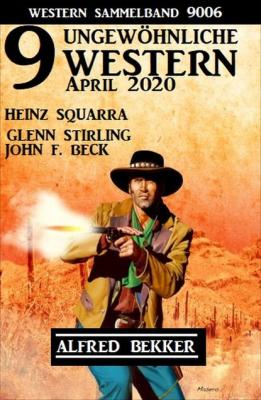ТОП просматриваемых книг сайта:
9 ungewöhnliche Western April 2020: Western Sammelband 9006. Alfred Bekker
Читать онлайн.Название 9 ungewöhnliche Western April 2020: Western Sammelband 9006
Год выпуска 0
isbn 9783745212129
Автор произведения Alfred Bekker
Жанр Вестерны
Издательство Readbox publishing GmbH
Die anderen Pferde galoppierten rechts und links an ihm vorbei.
Spinola beruhigte den Rappen, den er mit sicherer Hand gefangen hatte, führte ihn hinaus und band ihn an den Zaun. Gemeinsam mit Silva hängte er das Gatter ein. Der Peon lief zur Remise und schleppte den schweren Sattel heran.
„Soll ich nicht mitreiten?“, fragte der Peon.
Spinola legte dem Rappen den Sattel auf. „Du gehst ins Haus und legst das Gewehr keine Sekunde aus der Hand, bis ich wieder zurück bin, klar?“
„Gut.“ Der Peon zuckte mit den Schultern, nahm sein Gewehr, das er an den Zaun gelehnt hatte, und wandte sich dem Haus zu.
Zwei Minuten später ritt Spinola vom Rancho. Silva, der alte, stoppelbärtige Mann, stand im Haus und schaute ihm durch das Fenster nach.
„Es ist unsinnig“, murmelte er. „Vielleicht warten die nur darauf, dass er sich sehen lässt.“
2
Jiminez Spinola zügelte sein Pferd. Das Gewehr mit dem Ellenbogen gegen die Hüfte gepresst, schaute er in den Hohlweg vor sich und lauschte.
Es blieb still um den einsamen Reiter, der nach dem Killer seiner Pferde suchte. Er war hier richtig, das wusste er. Denn auf dem Boden sah er im Schimmern der Sonne ein paar Messinghülsen, große schwere Hülsen mit gewaltigen Pulvertreibsätzen, wie sie in eine Sharps-Rifle passten.
Spinola blickte zurück. Er hielt am Ende des Hohlweges und war einen Saumpfad an der Felswand heraufgeritten. Weit im Osten und gut fünfzig Yards tiefer sah er seine weiße Adobelehmhütte und dahinter die Remise, den Brunnen, die Schuppen und die Korrals.
An dieser Stelle hatte der Schütze gestanden. Mit einem guten, weittragenden Gewehr hatte er mit sicherer Hand geschossen.
Spinola war überzeugt, dass es sich so verhielt. Um sich jedoch dessen zu versichern, saß er ab, ging zu den schimmernden Patronenhülsen, hob eine auf und roch an ihr.
Der Gestank des verbrannten Schwarzpulvers stieg ihm in die Nase.
Er warf die Patrone weg, führte den Rappen durch den Hohlweg und suchte nach Spuren. Doch nirgendwo war etwas Verdächtiges zu entdecken.
Spinola blieb immer wieder stehen, bückte sich und suchte genauer. Aber er schüttelte den Kopf. Das Pferd des heimtückischen Schurken hatte keinen einzigen Eindruck hinterlassen.
Manchmal schnaubte der Rappe und schaute mit spielenden Ohren an dem Mexikaner vorbei.
Spinola duckte sich jedes Mal und schlug das Gewehr an.
Doch außer den grauen Felsen der Sierra Potosi war nichts in der Nähe. Sie schienen ihn anzugrinsen, diese Felsen.
„Ich finde dich!“, rief der Mexikaner in den Hohlweg. Das Echo schallte wie Gelächter zurück und drohte ihn um den Rest seiner Beherrschung zu bringen.
3
Silva atmete erleichtert auf, als Jiminez Spinola offenbar unverletzt aus dem Walde im Süden ritt und sich dem Rancho näherte. Spinola hielt das Gewehr in der Armbeuge und hatte sich den Hut tief in die Stirn gezogen.
Die Sonne stand senkrecht über dem Rancho. Die Gluthitze des Sommertages wurde von den schroffen Felsen im Westen verstärkt, so dass es heiß wie in einem Ofen war. Zumindest erschien er dem Peon so.
Er war hinter den Korrals dabei, eine Grube für die Pferdekadaver auszuheben, stützte sich nun auf die Schaufel und wartete. Schweiß lief ihm über das Gesicht.
Spinola zügelte das Pferd am Zaun und schüttelte den Kopf. „Nicht die geringste Spur. Als wäre das Pferd geflogen.“
„Er wird ihm Lappen um die Hufe gewickelt haben, damit es keine Spuren hinterlässt.“
„Es scheint so.“ Jiminez Spinola stieg ab und schob das Gewehr in den Scabbard. „Aber ich werde ihn finden und töten, das schwöre ich, bei allem, was uns heilig ist!“
Silva wischte den Schweiß vom Gesicht, rückte den alten Strohsombrero gerade, stieg in die Grube hinunter und schaufelte die Erde heraus.
Spinola wartete ein paar Sekunden, ob der Peon noch etwas sagen würde. Als dies nicht geschah, wandte er sich dem Korral zu und sattelte das Pferd ab.
Silva hatte alle Pferde inzwischen in einen anderen Korral getrieben, der vorher leer gestanden hatte, um das Gras darin wachsen zu lassen. Jetzt führte auch Jiminez Spinola seinen Rappen in den anderen Korral. Er blieb danach vor dem offenen Gatter des nun leeren Brettergevierts stehen und schaute auf die Kadaver, deren Körper in der Sonne aufgedunsen waren. Geier kreisten angelockt am Himmel und schickten ihr krächzend forderndes Geschrei hinunter. Manchmal stieß ein Vogel nach unten, fing sich aber einige Yards über den reglosen Körpern und stieg mit heftig schlagenden Flügeln wieder in die Höhe.
Spinola half wenig später dem Peon die Grube zu vergrößern und tiefer zu schaufeln. Doch immer wieder hielt er inne und schaute sich um. Besonders lange haftete sein Blick auf den Bergen im Westen. Noch immer hatte er das Gefühl, als würden sie ihn boshaft angrinsen.
„Morgen muss trotzdem die Bestellung ausgeführt werden, Silva.“
„Ich weiß.“
„Dann ist niemand mehr hier. Ich kann nicht allein mit den Pferden reiten.“
„Ich weiß.“ Silva wischte sich abermals den Schweiß vom Gesicht. Da er aber keinen Rat wusste, schaufelte er weiter.
Und weil Jiminez Spinola auch keinen Ausweg sah, half er dem Peon.
Alsbald war das Loch tief genug. Sie gingen zum Korral, banden Lassos an die Beine des ersten Kadavers, holten ein Pferd, schirrten es an, als solle es vor einen Wagen gespannt werden, banden aber dann die Lasso an das Ortscheit und schleiften den Kadaver aus dem Korral. Silva führte das Zuchtpferd so an der Grube vorbei, dass der Kadaver in das Loch stürzte.
Auf gleiche Art holten sie die beiden anderen verendeten Tiere, brachten das Zuchtpferd in den Korral zurück und schaufelten danach die Grube zu. Spinola tat es mit abgewandtem Gesicht, bis endlich die Erdschicht die Kadaver völlig bedeckte. Und noch einmal schwor er sich dabei, blutige Rache zu nehmen.
4
Carringo und Chaco ritten durch die Sierra Potosi nach Südosten. Nachdem sie von Manuela Felipez erfahren hatten, dass sie Marido, den Samurai, in Tampico gesehen hätten, war von ihnen keine Pause mehr eingelegt worden, um die ferne Stadt zu erreichen.
Jedoch schien es ihnen seit Stunden, als hätten sie sich verirrt. Der eingeschlagene Weg stieg immer steiler an. Die Gegend um sie herum wurde zusehends unwirtlicher. Das aus dem Boden sprießende Gras war kaum noch handhoch. Sahen sie in der rauen Bergeinsamkeit einmal ein paar Büsche, dann handelte es sich um vertrocknetes, niederes Dickicht, das den Namen Buschwerk kaum verdiente. Zudem wurden die Felsen über ihnen flacher.
Carringo zügelte schließlich seinen braunen Hengst, legte die Hände auf dem Sattelhorn übereinander und schaute zögernd in den schmalen Spalt, in den der Weg an dieser Stelle mündete.
„Ich schätze, wir sind vom Wege abgekommen.“ Chaco, das Halbblut, rieb sich das faltenzerfurchte Gesicht.
„Das allerdings denke ich auch“, sagte Carringo widerwillig. „Der Fahrweg dürfte um mehr als hundert Yards tiefer liegen. Hier schafft es an manchen Stellen bestenfalls eine sechsspännige Kutsche, die obendrein von Pferden und nicht von Mulis gezogen werden muss. Das hat man hier selten.“
Chaco nickte zustimmend.
„Aber vermutlich haben wir den Weg schon vor Stunden verlassen, ohne es zu merken“, fuhr Carringo