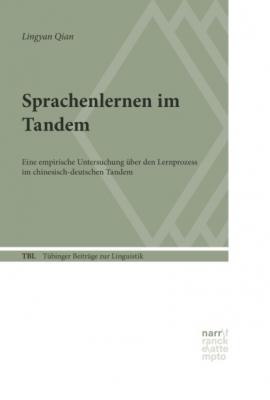ТОП просматриваемых книг сайта:
Sprachenlernen im Tandem. Lingyan Qian
Читать онлайн.Название Sprachenlernen im Tandem
Год выпуска 0
isbn 9783823300182
Автор произведения Lingyan Qian
Жанр Документальная литература
Серия Tübinger Beiträge zur Linguistik (TBL)
Издательство Bookwire
Allerdings gibt es nach Bechtel auch Grenzen der Tandemarbeit in Bezug auf das interkulturelle Lernen. Erstens ist die Tandem-Interaktion ein individueller Prozess, der auf einer persönlichen Sympathie fußt. Die Grenze wird erreicht, wenn die Tandempartner nicht bereit sind, etwas von sich preiszugeben (Bechtel 2003: 368). Zweitens stellt sich die Frage, inwieweit die von den Tandempartnern gegebenen Antworten in Bezug auf kulturelle, insbesondere landskundliche Informationen richtig, repräsentativ und vollständig sind (Bechtel 2003: 367). In direkter Interaktion mit dem muttersprachlichen Tandempartner bekommt der Lerner zwar „authentische, aktuelle, lebensnahe Auskünfte über die fremde Kultur“ (Bechtel 2003: 369). Aber diese Informationen über die Zielkultur wird von der Subjektivität des Muttersprachlers geprägt und kann die „Komplexität und Heterogenität der fremden Kultur“ (Bechtel 2003: 369) nicht gut reflektieren. Drittens geht es beim interkulturellen Lernen auch darum, die interkulturelle Handlungskompetenz der Lerner zu fördern. Sie sollten befähigt werden, sich der geistigen Prozesse, die beim interkulturellen Lernen eine Rolle spielen (Wahrnehmung, Kulturvergleich, Perspektivenübernahmen), bewusst zu werden und sie in Zukunft angemessen anzuwenden. Die Tandempartner als Laienlehrpersonen sind aber überfordert, solche Prozesse bewusst zu machen.
Anhand von Gesprächsausschnitten analysiert Qian (2013) Kulturreflexion im Sprachlerntandem zwischen deutschen und chinesischen Lernern. Sie zeigt dabei auf, wie die Erwartungen an die Erklärung kultureller Phänomene seitens der deutschen Muttersprachler und der chinesischen Lerner auseinandergehen. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung verdeutlichen, wie die muttersprachlichen Tandempartner die kulturellen Vorstellungen der chinesischen Lerner bagatellisieren und eigene Praktiken entgegenhalten, ohne diese näher zu thematisieren. Mögliche Gründe dafür könnten sein:
Die Gründe liegen einerseits vermutlich darin, dass die fremde Kultur für die Ausländer interessant ist (wie z.B. die folkloristischen Elemente), für die Einheimischen hingegen normal. Andererseits verlangt es fachliches Wissen, um spezifische kulturelle Fragen beantworten zu können. Das können nicht alle deutschen Studierenden leisten. (Qian 2013: 71)
1.1.2.3.3 Beratungen und Begleitungen
Ein weiteres Gebiet der Tandemforschung, das sich in den letzten Jahren schnell entwickelt hat, behandelt Beratungen und Begleitungen für Tandem-Interaktionen. Darunter sind Anleitungen bei der Reflexion eigenen Handelns im Tandem zu verstehen. Dabei werden Leitfaden und Materialien für das Lernen entwickelt. In der Praxis stehen verschiedene Beratungsangebote an unterschiedlichen Hochschulen zu Verfügung.
Holstein/Oomen-Welke (2006) stellten aufgrund der Fachliteratur sowie langjährigen eigenen Erfahrungen mit dem Freiburger Tandem-Büro der Pädagogischen Hochschule, aus der Tandem-Vermittlung der Universität Gießen und bei der Fundazioa Tandem einen ausführlichen und umfangreichen Leitfaden für das Sprachenlernen im Tandem zusammen. Darin werden theoretische Prinzipien und praktische Tipps für den Ablauf der Tandemarbeit vorgestellt. In dem von Baguette et al. (2001) herausgegebenen Buch wird ein Leitfaden speziell für die schulischen Tandem-Interaktionen beschrieben. Das Sammelwerk von Brammerts/Little (1996) gibt einen Überblick über das Sprachenlernen im Tandem im Internet. Eine wissenschaftliche Untersuchung, die das Sprachenlernen im Tandem aus der Perspektive von Beratungen und Begleitungen umfassend und systematisch erforscht, liegt in Schmelters (2004) Studie vor. Schmelter untersucht die Tandemarbeit anhand empirischer Daten. Sein Korpus besteht aus Eingangs-und Abschlussinterviews (als Beratungsgesprächen), Beobachtungen der Tandemsitzungen, Kommentierungen der Lerner zu den Sitzungen und Tagebüchern. Während Beratungsangebote im Tandembereich geschätzt werden, weist Schmelter in seiner Studie aber auf verschiedene problematische Aspekte der Beratungen für die Tandemarbeit hin.
Eine grundsätzliche Problematik für Beratungsangebote liegt nach Schmelter darin, dass die Lerner den Bedarf nicht erkennen, Beratungsgespräche für Tandem zu nutzen (Schmelter 2004: 343). Oft wissen sie nicht, dass die vorhandenen Situationen mehr Möglichkeiten für das Lernpotenzial bieten können, als ihnen momentan bewusst ist. Zweitens stellt sich dann die Frage, ob der Beratungsbesuch zur Verpflichtung werden sollte (Schmelter 2004: 344). Das würde einerseits gegen das autonome Lernprinzip des Tandems stehen. Andererseits würde die Motivation zum Lernen nicht ausreichend geweckt. Drittens geht es um das Verhalten und die Rolle der Berater. Inwieweit dürfen die Berater in das selbstgesteuerte Lernen im Tandem eingreifen, ohne den eigentlichen Charakter der Tandem-Interaktion aufzuheben (Schmelter 2004: 344) ?
Es würde sich lohnen, solche Problematiken zu untersuchen. Das wäre nicht nur für die Verbesserung der Beratungsangebote nützlich, sondern auch für einen besseren Einblick in das subjektive Empfinden der Lerner. Nach Schmelter (2004: 329) fehlen bislang systematisch erhobene empirische Befunde zu der Frage, welcher Lerner aus welchen Gründen und mit welchen Zielen die Beratung in didaktischen Umfeldern zum selbstgesteuerten Lernen aufsucht.
Das Problem, dass die Tandempartner das Lernpotenzial in dieser Situation ungenügend kennen, unterstreicht auch Brammerts (2006). Seiner Beobachtung zufolge wissen die Lerner nicht, über ihre eigenen „Lernziele und Lernwege“ (Brammerts 2006: 6) zu entscheiden. Denn, so schreibt er:
Sie verstehen den Partner als persönlichen fremdsprachigen Kommunikationspartner, verlassen sich darauf, dass man durch Kommunikation mit einem native speaker immer etwas lernt, und behalten in der Regel auch Recht damit. (Brammerts 2006: 6)
Ausgehend davon, die Chancen in diesem besonderen Lehr-Lern-Kontext zu erhöhen, schlägt Brammerts (2006) vor, den Tandemlernern Unterstützungen zu bieten, damit sie die Möglichkeiten zum Erreichen ihrer Ziele optimal nutzen können. Brammerts (2006: 6–8) benennt folgende Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen, die als Hilfestellung für das Tandemlernen angeboten werden:
Bereitstellung von Informationen (Erklärungen, Anleitungen, Grundregeln, Tipps)
Anregungen für die Tandemarbeit
Anregungen zur Reflexion für den einzelnen Lerner
Anregungen zur Reflexion innerhalb der Tandempaare
gelenkte Reflexion in Gruppen
Paarberatung
individuelle Beratung.
Reinecke (2013) stellt ihre Erfahrungen von und mit Studierenden in der Tandemberatung vor. In ihrem Aufsatz betont sie die grundsätzliche Problematik, dass die Angebote der Tandemberatung nicht von den Lernern genügend genutzt werden. Dazu schreibt sie wie folgt:
Während sich dabei einerseits sehr positive Tendenzen abzeichnen – das Tandem wird von den Studierenden gut angenommen und engagiert durchgeführt – weisen die bisher erhaltenen Ergebnisse und Rückmeldungen aber auch auf ein nicht untypisches Problem von Beratungsangeboten hin: Sie werden von Betroffenen theoretisch für sinnvoll erachtet, aber nicht unbedingt genutzt. (Reinecke 2013: 77–78)
In Anlehnung an die oben genannten Untersützungsformate von Brammerts (2006: 6–8) weist sie anhand ihrer Erfahrungen darauf hin, dass man bei der Tandemberatung „Lernstrategientraining“ von „Autonomieförderung“ (Reinecke 2013: 81) unterscheiden soll. Denn es ist in der Praxis zu beweisen, dass die Vermittlung des strategischen Wissens (wie Bedeutungserklärungen, Korrekturen, Gliederungssignale) relativ problemlos ist. Aber die Förderung der Autonomie im Tandem soll sich nicht auf die Vermittlung der technischen Aspekte beschränken.
Angesichts dieser Tatsache schlägt die Autorin vor, die beiden unterschiedlichen Begleitangebote für das Tandemlernen – „Lernstrategientraining“ und „Autonomieförderung“ – institutionell-personell voneinander zu trennen. Ihrer Meinung nach könnte die Strategienvermittlung die Aufgabe der Lehrenden sein, während die Angebote zur Autonomieförderung durch eine Einrichtung (wie Tandembüro) durchgeführt würde (Reinecke 2013: 101). Das Ziel dieser Umstrukturierung soll darin liegen, das Potenzial des Strategientrainings und der Lernerautonomie im Tandemlernen zu verbessern.
1.2 Zusammenfassung