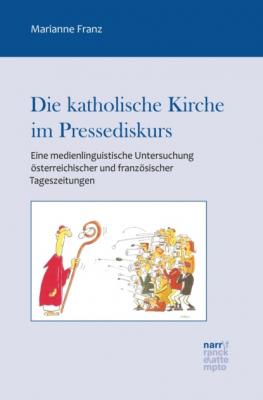ТОП просматриваемых книг сайта:
Die katholische Kirche im Pressediskurs. Marianne Franz
Читать онлайн.Название Die katholische Kirche im Pressediskurs
Год выпуска 0
isbn 9783823300236
Автор произведения Marianne Franz
Жанр Документальная литература
Серия Europäische Studien zur Textlinguistik
Издательство Bookwire
Nichtsdestoweniger wurde die Kirche bislang als Thema sowohl in der Linguistik als auch in der Medien- und KommunikationswissenschaftKommunikationswissenschaft weitgehend ignoriert. Dort konzentriert man sich vor allem auf die Analyse der Presse-Berichterstattung in Hinblick auf politische Themen (z.B. Ausländerfeindlichkeit in der Presse; ethnische Minderheiten, Kernenergie, die EU-Erweiterung, politische Parteien im Vorlauf diverser Wahlen usw.) (vgl. auch Abschnitt 8).
Dass Kirche Kulturkampfpotenzial hat, zeigte sich auch schon in der Geschichte Frankreichs (vgl. Abschnitt 7.2). Heute herrscht dort eine strikte Trennung zwischen Staat und Kirche; viel strikter, als es in Österreich der Fall ist (vgl. Abschnitt 7.1), wo Staat und Kirche in vielen Bereichen kooperieren. Gerade dieser Unterschied macht einen Vergleich dieser beiden Länder interessant. Es bleibt festzustellen, ob sich die unterschiedlichen Staat-Kirche-Systeme in der Berichterstattung der Medien widerspiegeln. Auch dieser länderübergreifende Vergleich bildet ein Novum, das aufschlussreiche Ergebnisse zu den soziokulturellen und sprachlichen Besonderheiten der beiden Länder verspricht.
Alle Medien zu untersuchen sprengt die Ressourcen einer einzelnen Dissertantin. So wurde das MediumMedium der Tageszeitung ausgewählt, das nicht nur ein verhältnismäßig leicht zu handhabender Untersuchungsgegenstand ist, sondern das sowohl in Österreich als auch in Frankreich ein sehr beliebtes Medium und insofern repräsentativ ist (vgl. Kapitel 9).
Im Folgenden werden das Forschungsobjekt, die der Untersuchung zugrunde liegenden Hypothesen, das Untersuchungsdesign und der Aufbau der vorliegenden Arbeit genauer erläutert.
1.1 Forschungsobjekt
Medien sind „Weltbildapparate“, so Winfried Schulz in Anlehnung an Konrad Lorenz, der mit dieser Bezeichnung den Einfluss des menschlichen Informationsverarbeitungssystems auf die Weltbild-Konstruktion hervorhob. Auch die Medien wählen – wie das menschliche Informationsverarbeitungssystem –
„aus der unendlichen Fülle von Zuständen und Vorgängen in der Welt einige wenige aus, unterziehen sie einem Verarbeitungsprozeß und entwerfen daraus ihr Weltbild. Dieses hat für die Gesellschaft einen ähnlich ‚objektiven‘, verbindlichen Charakter wie es die individuelle Weltwahrnehmung hat. So wie wir unseren Augen trauen, verlassen wir uns auch auf die Berichterstattung der Medien“ (Schulz 1997: 49; vgl. auch Abschnitt 2.3 Kommunikatorforschung).
Manchen Kirchenmitgliedern ist genau das ein Dorn im Auge. Sie sorgen sich, dass die Menschen, die die Kirche nur mehr aufgrund der Medienberichterstattung und nicht aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen mit der Kirche kennen, ein negatives Bild von Kirche vermittelt bekommen und dieses mediale Bild für real halten.Bewertung
Wissenschaftlich gesehen kann ein mediales Weltbild jedoch ohnehin „niemals ein Abbild der Wirklichkeit“ sein (Burkart 2002: 275). Nach konstruktivistischer Sicht ist die Wahrnehmung und Abbildung einer objektiven RealitätRealität, objektive nicht möglich, da die menschliche Informationsverarbeitung unweigerlich eine Reduktion dieser Realität mit sich bringt. Die Frage lautet also nicht „‚Wie (gut oder schlecht) bilden die Medien die Wirklichkeit ab?‘, sondern ‚Wie [re-]konstruieren die Medien die Wirklichkeit?‘“ (Burkart 2002: 274f.) (vgl. auch Abschnitt 2.4.1).
Die vorliegende Arbeit will dieser Frage auf den Grund gehen. Sie nimmt ein konkretes medial rekonstruiertes Weltbild genauer in Augenschein: das Bild der römisch-katholischen Kirche, wie es von den österreichischen und französischen Tageszeitungen geschaffen wird. Dazu werden Zeitungsartikel hinsichtlich der berichteten kirchlichen Themen sowie hinsichtlich ihrer inhaltlichen und sprachlichen Darstellung und der getätigten Bewertungen analysiert. Für die Untersuchung wurden je drei österreichische und französische Tageszeitungen mit nationaler Reichweite (je zwei QualitätszeitungenQualitätszeitung und eine BoulevardzeitungBoulevardzeitung) ausgewählt. In Österreich sind das Die Presse, Der Standard und die Kronen Zeitung; in Frankreich Le Figaro, Le Monde und Aujourd’hui en France. Berücksichtigt wurden informations- undPressetextsorten, informationsbetonte meinungsbetontePressetextsorten, meinungsbetonte TextsortenPressetextsorten, die die katholische Kirche zum Thema hatten und die Linie der jeweiligen Redaktion widerspiegelten.
Seit Beginn meiner Untersuchungen im Jahr 2008 riss die Berichterstattung über die Kirche nicht ab. Es mag dazwischen Zeiten gegeben haben, wo es ruhiger um die Kirche geworden ist, doch über weite Strecken war das Thema Kirche kontinuierlich präsent. Immer wieder tauchten neue Diskursereignisse auf, die eine Riesenwelle an medialer Berichterstattung auslösten; im Jahr 2009 waren es päpstliche Aussagen zum Kondom während seiner Afrikareise oder auch die aufgehobene Exkommunikation der Bischöfe der Piusbruderschaft (einer von ihnen leugnet annähernd zeitgleich den Holocaust); in Österreich folgten im Jahr 2010 der Skandal der zahlreichen aufgedeckten Fälle von Kindesmissbrauch innerhalb der österreichischen Kirche oder im Jahr 2011 der Aufruf zum Ungehorsam gegenüber der Kirchenleitung von der österreichischen Pfarrerinitative (ein Verein von österreichischen Pfarrern, der für die Reform der Kirche eintritt) – um nur einige Beispiele zu nennen. Es stellte sich bald heraus, dass es unmöglich war, alles abzudecken. Das Korpus musste stark eingeschränkt werden. Um dennoch allgemeine Aussagen treffen zu können, wurde nicht ein einzelnes diskursives EreignisDiskursives Ereignis (z.B. Kondomdebatte) untersucht, sondern die Berichterstattung über einen längeren Zeitraum verfolgt, indem eine StichprobeStichprobe (s. a. Künstliche Woche) der zwischen Jänner und Juni 2009 zum Thema „katholische Kirche“ erschienenen Artikel gezogen wurde. Insgesamt wurden 212 Artikel untersucht (Genaueres siehe Abschnitt 11.1, außerdem Abschnitte 12.1 und 13.1).
1.2 Hypothesen
Die Untersuchung ging von folgenden Hypothesen in Bezug auf die Beschaffenheit der Berichterstattung über die katholische Kirche aus:
(1) Einfluss der NachrichtenfaktorenNachrichtenfaktoren sowie der Welt- und WertvorstellungenWelt- und Wertvorstellungen
Die Konstruktion der MedienrealitätMedienwirklichkeitMedienrealitätMedienwirklichkeit „Kirche“ vollzieht sich einerseits unter dem Einfluss der NachrichtenfaktorenNachrichtenfaktoren (d.h. der Eigenschaften eines Ereignisses, die darüber bestimmen, ob es in die Berichterstattung Eingang findet oder nicht, z.B. Prominenz der beteiligten Personen, räumliche Nähe des Ereignisses zu den LeserInnen, Dramatik usw.), andererseits unter dem Einfluss der Welt- und Wertvorstellungen der jeweiligen RedakteurInnen.
(2) ThemenselektionThemenselektion
Die NachrichtenfaktorenNachrichtenfaktoren und die Welt- und WertvorstellungenWelt- und Wertvorstellungen der jeweiligen RedakteurInnen wirken sich auf die Themensteuerung aus. Die Tageszeitungen berichten einseitig über die Kirche. Das Verhältnis der Bandbreite kirchlichen Geschehens in der Realität zu den in den Tageszeitungen wiedergegebenen Geschehnissen stimmt nicht überein. Im Detail bedeutet dies:
Die Berichterstattung ist auf „heiße Eisen“ fokussiert. Dazu gehören nach Bauer (vgl. 1997: 5f.) inner- und außerkirchlich heiß diskutierte Themen wie die Sexualmoral der Kirche, in diesem Zusammenhang auch Geburtenregelung, Schwangerschaftsabbruch, Homosexualität und Zölibat; weiters das Verhältnis zwischen den Religionen (Juden und Christen bzw. Muslime und Christen) sowie das Verhältnis zwischen den Konfessionen (Ökumene), Kirchenbeitrag oder auch der Primat des Papstes.