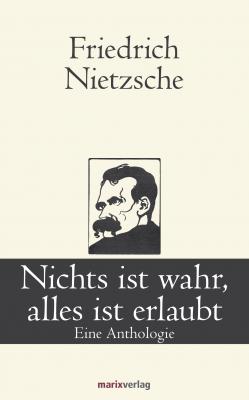ТОП просматриваемых книг сайта:















Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Friedrich Nietzsche
Читать онлайн.Название Nichts ist wahr, alles ist erlaubt
Год выпуска 0
isbn 9783843802970
Автор произведения Friedrich Nietzsche
Жанр Языкознание
Серия Klassiker der Weltliteratur
Издательство Bookwire
In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der »Weltgeschichte«: aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, und die klugen Tiere mussten sterben. – So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben.
Ich will, ein für alle Mal, Vieles nicht wissen. – Die Weisheit zieht auch der Erkenntnis Grenzen.
Vom Baum der Erkenntnis. – Wahrscheinlichkeit, aber keine Wahrheit: Freischeinlichkeit, aber keine Freiheit, – diese beiden Früchte sind es, derentwegen der Baum der Erkenntnis nicht mit dem Baum des Lebens verwechselt werden kann.
Wir nennen einen Menschen »ehrlich«. Warum hat er heute so ehrlich gehandelt? fragen wir. Unsere Antwort pflegt zu lauten: seiner Ehrlichkeit wegen. Die Ehrlichkeit! Das heißt wieder: das Blatt ist die Ursache der Blätter. Wir wissen ja gar nichts von einer wesenhaften Qualität, die »die Ehrlichkeit« hieße, wohl aber von zahlreichen individualisierten, somit ungleichen Handlungen, die wir durch Weglassen des Ungleichen gleichsetzen und jetzt als ehrliche Handlungen bezeichnen; zuletzt formulieren wir aus ihnen eine qualitas occulta mit dem Namen: »die Ehrlichkeit«. Das Übersehen des Individuellen und Wirklichen gibt uns den Begriff, wie es uns auch die Form gibt, wohingegen die Natur keine Formen und Begriffe, also auch keine Gattungen kennt, sondern nur ein für uns unzugängliches und undefinierbares X.
Letzte Skepsis. – Was sind denn zuletzt die Wahrheiten des Menschen? – Es sind die unwiderlegbaren Irrtümer des Menschen.
Es ist furchtbar, im Meere vor Durst zu sterben. Müsst ihr denn gleich eure Wahrheit so salzen, dass sie nicht einmal mehr – den Durst löscht?
Der Intellekt, als ein Mittel zur Erhaltung des Individuums, entfaltet seine Hauptkräfte in der Verstellung; denn diese ist das Mittel, durch das die schwächeren, weniger robusten Individuen sich erhalten, als welchen einen Kampf um die Existenz mit Hörnern oder scharfem Raubtier-Gebiss zu führen versagt ist. Im Menschen kommt diese Verstellungskunst auf ihren Gipfel: hier ist die Täuschung, das Schmeicheln, Lügen und Trügen, das Hinter-dem-Rücken-Reden, das Repräsentieren, das im erborgten Glanze Leben, das Maskiertsein, die verhüllende Konvention, das Bühnenspiel vor anderen und vor sich selbst, kurz das fortwährende Herumflattern um die eine Flamme Eitelkeit so sehr die Regel und das Gesetz, dass fast nichts unbegreiflicher ist, als wie unter den Menschen ein ehrlicher und reiner Trieb zur Wahrheit aufkommen konnte.
Wahrheit. – Niemand stirbt jetzt an tödlichen Wahrheiten: es gibt zu viele Gegengifte.
Das Über-Tier. – Die Bestie in uns will belogen werden; Moral ist Notlüge, damit wir von ihr nicht zerrissen werden. Ohne die Irrtümer, welche in den Annahmen der Moral liegen, wäre der Mensch Tier geblieben. So aber hat er sich als etwas Höheres genommen und sich strengere Gesetze auferlegt. Er hat deshalb einen Hass gegen die der Tierheit näher gebliebenen Stufen: woraus die ehemalige Missachtung des Sklaven, als eines Nicht-Menschen, als einer Sache zu erklären ist.
Die gute und die böse Natur. – Erst haben die Menschen sich in die Natur hineingedichtet: sie sahen überall sich und Ihresgleichen, nämlich ihre böse und launenhafte Gesinnung, gleichsam versteckt unter Wolken, Gewittern, Raubtieren, Bäumen und Kräutern: damals erfanden sie die »böse Natur«. Dann kam einmal eine Zeit, da sie sich wieder aus der Natur hinausdichteten, die Zeit Rousseaus: man war einander so satt, dass man durchaus einen Weltwinkel haben wollte, wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual: man erfand die »gute Natur«.
Der Taschenspieler und sein Widerspiel. – Das Erstaunliche in der Wissenschaft ist dem Erstaunlichen in der Kunst des Taschenspielers entgegengesetzt. Denn dieser will uns dafür gewinnen, eine sehr einfache Kausalität dort zu sehen, wo in Wahrheit eine sehr komplizierte Kausalität in Tätigkeit ist. Die Wissenschaft dagegen nötigt uns, den Glauben an einfache Kausalitäten gerade dort aufzugeben, wo alles so leicht begreiflich scheint und wir die Narren des Augenscheins sind. Die »einfachsten« Dinge sind sehr kompliziert, – man kann sich nicht genug darüber verwundern!
»Erkenne dich selbst« ist die ganze Wissenschaft. – Erst am Ende der Erkenntnis aller Dinge wird der Mensch sich selber erkannt haben. Denn die Dinge sind nur die Grenzen des Menschen.
Wahrheit als Circe. – Der Irrtum hat aus Tieren Menschen gemacht; sollte die Wahrheit im Stande sein, aus dem Menschen wieder ein Tier zu machen?
Gegen Bilder und Gleichnisse. – Mit Bildern, und Gleichnissen überzeugt man, aber beweist nicht. Deshalb hat man innerhalb der Wissenschaft eine solche Scheu vor Bildern und Gleichnissen; man will hier gerade das Überzeugende, das Glaublich-Machende nicht und fordert vielmehr das kälteste Misstrauen auch schon durch die Ausdrucksweise und die kahlen Wände heraus: weil das Misstrauen der Prüfstein für das Gold der Gewissheit ist.
Soweit das Individuum sich, gegenüber andern Individuen, erhalten will, benutzt es in einem natürlichen Zustand der Dinge den Intellekt zumeist nur zur Verstellung: Weil aber der Mensch zugleich aus Not und Langeweile gesellschaftlich und herdenweise existieren will, braucht er einen Friedensschluss und trachtet danach, dass wenigstens das allergrößte bellum omnium contra omnes aus seiner Welt verschwinde. Dieser Friedensschluss bringt etwas mit sich, was wie der erste Schritt zur Erlangung jenes rätselhaften Wahrheitstriebes aussieht. Jetzt wird nämlich das fixiert, was von nun an »Wahrheit« sein soll, das heißt, es wird eine gleichmäßig gültige und verbindliche Bezeichnung der Dinge erfunden, und die Gesetzgebung der Sprache gibt auch die ersten Gesetze der Wahrheit: denn es entsteht hier zum ersten Male der Kontrast von Wahrheit und Lüge.
Das Bewusstsein. – Die Bewusstheit ist die letzte und späteste Entwickelung des Organischen und folglich auch das Unfertigste und Unkräftigste daran. Aus der Bewusstheit stammen unzählige Fehlgriffe, welche machen, dass ein Tier, ein Mensch zu Grunde geht, früher als es nötig wäre, »über das Geschick«, wie Homer sagt. Wäre nicht der erhaltende Verband der Instinkte so überaus viel mächtiger, diente er nicht im Ganzen als Regulator: an ihrem verkehrten Urteilen und Phantasieren mit offenen Augen, an ihrer Ungründlichkeit und Leichtgläubigkeit, kurz eben an ihrer Bewusstheit müsste die Menschheit zu Grunde gehen: oder vielmehr, ohne jenes gäbe es diese längst nicht mehr! Bevor eine Funktion ausgebildet und reif ist, ist sie eine Gefahr des Organismus: gut, wenn sie so lange tüchtig tyrannisiert wird! So wird die Bewusstheit tüchtig tyrannisiert – und nicht am wenigsten von dem Stolze darauf! Man denkt, hier sei der Kern des Menschen; sein Bleibendes, Ewiges, Letztes, Ursprünglichstes! Man hält die Bewusstheit für eine feste gegebene Größe! Leugnet ihr Wachstum, ihre Intermittenzen! Nimmt sie als Einheit des Organismus! – Diese lächerliche Überschätzung und Verkennung des Bewusstseins hat die große Nützlichkeit zur Folge, dass damit eine allzu schnelle Ausbildung desselben verhindert worden ist. Weil die Menschen die Bewusstheit schon zu haben glaubten, haben sie sich wenig Mühe darum gegeben, sie zu erwerben – und auch jetzt noch steht es nicht