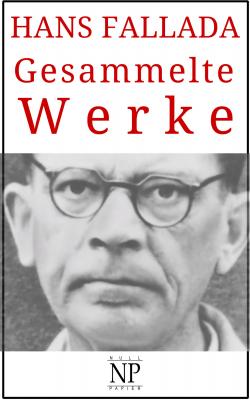ТОП просматриваемых книг сайта:
Hans Fallada – Gesammelte Werke. Hans Fallada
Читать онлайн.Название Hans Fallada – Gesammelte Werke
Год выпуска 0
isbn 9783962813598
Автор произведения Hans Fallada
Жанр Языкознание
Серия Gesammelte Werke bei Null Papier
Издательство Bookwire
Ich schälte mühsam meine Kartoffeln mit dem Löffel; Gabel und Messer waren in diesem Haus der ständigen Schlägereien zu gefährlich. Wenn ich die mit mir Essenden betrachtete, so sah ich einige, die taten wie ich; sie legten ihre Kartoffeln in die Sauce und warteten mit dem Essen, bis sie fertig mit Schälen waren. Aber wir waren bei Weitem in der Minderzahl, viele Schäler waren so ausgehungert, dass sie nicht warten konnten: Die meisten Kartoffeln verschwanden eben geschält im Munde, nur wenige erreichten die Brühe.
Schälen taten, wie ich sah, alle die Kartoffeln, aber ich sah in meiner Nähe einen dicken, untersetzten Mann mit eisengrauem Kopf und dem rotbraun gebrannten Gesicht eines Landarbeiters, der während des Schälens auch die Schalen auffraß. Kaum hatte ich fertiggeschält, warf er einen fragenden Blick auf mich, und schon fuhr seine schwielige Hand über den Tisch, kratzte auf einmal all meinen Abfall zusammen und schob ihn in den Mund.
»Mann!«, rief ich. »Da war ja eine völlig verfaulte Kartoffel zwischen!«
»Macht nichts, Kumpel«, sagte er, eifrig kauend. »Ich muss den ganzen Tag mähen, ich werd’ nie satt. Vielleicht kann ich mir heute Abend Schweinekartoffeln klauen. Hoffentlich …«
Er war nicht ein einzelner Verfressener, alle hatten Hunger, immer, auch direkt nach dem Essen. Ich sah Kranke herumgehen und die kleinsten Kartoffelkrümelchen von dem Tisch fortstehlen, andere kratzten die schon ach so blanken Schüsseln nach; einen sah ich auf dem Flur den Saucenkessel mit dem immer wieder abgeleckten Finger blank polieren. All dies geschah unter den Augen der Wachtmeister, die es als selbstverständlich ansahen.
Mir schien es unsäglich jämmerlich und gemein, Kranke so hungern zu lassen, aber auch sich zu solcher Schüsselleckerei und Abfallfresserei zu entwürdigen. Nur wenige Tage sollten vergehen, da dachte ich wesentlich anders darüber und war selbst sehr großzügig beim Schälen von Kartoffeln, das heißt, glatte Stellen ließ ich grundsätzlich ungeschält. Es ist ein sehr einfacher Satz: »Hunger tut weh«, aber seine Einfachheit nimmt nichts von seiner Wahrheit. Wer Nacht für Nacht vor Hunger nicht in den Schlaf kommen kann, wer am Tage schwindlig wird vor Hunger, der hat nur noch wenig Bedenken hinsichtlich der Nahrungsmittel, mit denen er seinen Hunger stillen kann.
Ich greife hier vor, aber ich möchte dieses Kapitel vom Essen in einer »Heil«-Anstalt endgültig zu Ende bringen, obwohl ich es für mich bis heute noch nicht zu Ende gebracht habe. In der ganzen Anstalt herrschte ein einfach schmutziger Geiz. Nie bekamen wir frisches Fleisch zu essen, nur manchmal schwammen Fasern – niemals auch nur Bröckchen! – eines roten, alten Pökelfleisches im Essen oder in der Sauce, sehr rare Fasern übrigens! Nie gab es Butter, nie Wurst, nie Käse. Nie einen Apfel. Und alles, was es gab, war dann auch noch unzulänglich, endlos mit Wasser vermischt, schlecht zubereitet.
Warum das alles so war, ahne ich noch heute nicht. Die Gefangenen behaupteten, der Oberinspektor fräße alles selbst auf. Aber auch der gefräßigste Oberinspektor kann nicht das Essen von ein paar Hundert Menschen vertilgen. Vielleicht wollte man uns nicht zu üppig werden lassen, und ich muss zugeben, selbst bei dieser Hungerkost waren die Leidenschaften noch lebhaft genug im Gange.
Es gab aber doch immer Leute unter uns, die nicht solchen Hunger litten, ja, die in gewissen Grenzen aus dem Vollen lebten, nämlich die Kalfaktoren, sie hatten die Brote für uns zu schneiden, abzuwiegen, zu bestreichen. Offiziell stand ein Wachtmeister dabei und passte auf, aber klingelte das Telefon, so musste der Wachtmeister aus der Küche heraus in den Glaskasten, und schon waren ein paar Stullen dick geschmiert und verschwunden. Gefangene haben scharfe Augen, und der Hunger macht sie nur noch schärfer; es war unvermeidlich, dass sie von diesen Unterschlagungen erfuhren. Der hatte gesehen, wie ein Kalfaktor auf dem Klo eine Stulle kaute, jener, wie er einem »Freund« eine zusteckte oder sie für Tabak verhandelte.
Aber anzeigen war sinnlos. Erst einmal war schwer etwas zu beweisen, ja, es war fast unmöglich, denn selbst wenn das Brot gefunden wird, was fast nie geschieht, weil nämlich gar nicht erst nach ihm gesucht wird, kann der Kalfaktor sagen: »Das habe ich mir vom Frühstück aufgespart.« Und zum anderen waren die Kalfaktoren das liebe Kind der Beamten, ihre Zuträger; die Beamten wollten nichts gegen ihre Kalfaktoren hören. So geschah praktisch nie etwas dagegen, aber der Neid und der Hass wurden dadurch ständig wachgehalten. Immerfort gab es Sticheleien, Anspielungen, auch Prügeleien. Bei denen zogen die Prügler immer den Kürzeren, sie wanderten in den Arrest; sie konnten ja nichts beweisen.
Auch ich war, ich muss es gestehen, oft fast krank vor Neid, wenn ich sah, wie unser immer fetter werdender Kalfaktor das Mittagessen nach ein paar Löffeln satt beiseiteschob, dieses selbe Mittagessen, bei dem ich mit jedem Bissen geizte; er aber schenkte es einem anderen oder verscheuerte es für einen Pfeifenkopf Tabak oder eine Zwiebel oder zwei Streichhölzer.
›Du Speckjäger!‹, sagte ich mir dann, genau wie die anderen, ›du hast dich an meinem Brot und meiner Margarine satt gefressen, und nun verschmähst du das kostbare Essen, das meinem Körper so notwendig wäre. Dass du verrecken mögest in deinem Fett!‹ – So fühlte ich und schämte mich dabei dieses erbärmlichen Futterneides um eine Scheibe Brot, die ich zu Hause für nichts geachtet hatte, und lernte die hassen, die mich dazu gebracht hatten, so zu fühlen, so niedrig und neidisch!
Eigentlich noch schlimmer als diese heimliche Art, sich Essensvorteile zu verschaffen, war eine ganz legale, die von der Verwaltung gebilligt, ja sogar gefördert wurde. Diejenigen der Insassen nämlich, die noch willige Verwandte draußen hatten, durften sich Pakete mit Lebensmitteln schicken lassen, so oft und so viel sie nur wollten.
Man sollte denken, dass fast jeder der Kranken einen solchen Angehörigen draußen hatte, der ihm wenigstens dann und wann ein Brot geschickt hätte – schon trocken Brot war eine heiß begehrte Ware im Hause. Dem war aber nicht so.
Ganz abgesehen davon, dass viele der Insassen weder schreiben noch lesen konnten (in diesem schrecklichen Hause lag wirklich nur der letzte Ausschuss der Menschheit) oder dass sie schon zu blöde und stumpf dafür waren, wollten die Angehörigen von den meisten nichts mehr wissen. Sie hatten ihnen, solange sie noch draußen