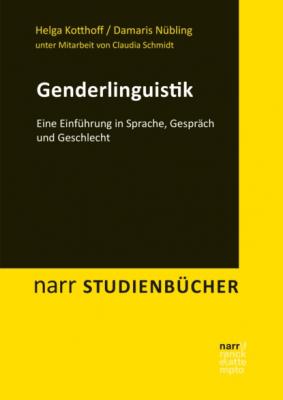ТОП просматриваемых книг сайта:
Genderlinguistik. Helga Kotthoff
Читать онлайн.Название Genderlinguistik
Год выпуска 0
isbn 9783823301523
Автор произведения Helga Kotthoff
Жанр Документальная литература
Серия narr studienbücher
Издательство Bookwire
Die bei der Geburt vorgenommene Klassifikation wird als lebenslang begriffen und mit der Vergabe eines ebenfalls lebenslang geltenden, vergeschlechtlichten Namens hör- und sichtbar gemacht (Kap. 9). Eltern, die ihrem Kind schon lange vor der Geburt einen Proto- bzw. Pränatalnamen geben, ändern diesen häufig mit der Geschlechtsdiagnose. Da der Mehrheitsglaube der an zwei Geschlechter ist und tief in Gesellschaft, Gesetze, Sprache etc. eingelassen ist, untersuchen wir diese historisch sehr alte Unterscheidung in der deutschen Sprache. In diesem nicht-biologistischen Sinn sprechen wir von Gender oder einfach nur von Geschlecht, das die Kopplung von Gender an GeschlechtsorganeGeschlechtsorgane weder negiert noch erfordert. Auch viele andere Gesellschaften beziehen bei der Geschlechterunterscheidung körperliche Geschlechtsmerkmale ein. Da das natürliche, biologische oder körperliche Geschlecht oft sichtbar ist sowie – auf vielfältigste Art und Weise – sichtbar gemacht wird und auch bei der Geschlechtszuweisung durchaus thematisiert wird (der hat ja gar keinen Bart! die hat ja einen richtigen Bart!), da wir außerdem bei Kühen, Bullen und anderen TierenTiere nicht von Gender sprechen können, sondern deren Geschlechtsklasse sich nur aus körperlichen Merkmalen ergibt, sprechen wir auch von Sexus.
Auch auf der biologischen Sexusebene gelangte in den letzten Jahrzehnten die (medizinisch schon ältere) Erkenntnis ins allgemeine Bewusstsein, dass sich eine strikte Zweigeschlechtlichkeit nicht aufrechterhalten lässt. Auf anatomischer (innere und äußere GeschlechtsorganeGeschlechtsorgane), chromosomaler und hormonaler Ebene existieren vielfältige Zwischentypen und -formen, die bislang bald nach der Geburt medizinisch zugunsten der Geschlechtsbinarität bearbeitet (‚vereindeutigt‘) wurden. Auch so schafft man zwei (und nur zwei) Geschlechter und bannt man Ambiguität.
Gegenwärtig können wir beobachten, dass sich immer mehr Geschlechter und Geschlechtsidentitäten Gehör und Respekt verschaffen, z.B. Intersex-PersonenIntersex (mit uneindeutigen GeschlechtsorganenGeschlechtsorgane), die heute nach der Geburt nicht mehr operativ vereindeutigt werden müssen (man wartet ihre eigene Entscheidung ab) und die seit neuestem von einem dritten Geschlechtseintrag („inter/divers“) Gebrauch machen können. Ebenso kann die GeschlechtsidentitätGeschlechtsidentität (auch soziales oder psychologisches Geschlecht genannt) von der genitalienbezogenen Zuordnung abweichen (TransgenderTransgender). Auch gibt es Personen, die sich jenseits jeglichen Geschlechts positionieren, jegliche Geschlechtszugehörigkeit also gekündigt haben (dem entsprechen in der Religion AtheistInnen): Sie weisen, egal, wie ihr Körper beschaffen ist, jegliche Vergeschlechtlichung von sich. Hier erlangen die GenitalienGenitalien den Status von Haarfarbe oder Sommersprossen, sie sind irrelevant. Dabei haben auch geschlechtsfreie Menschen mit der Tatsache zu kämpfen, dass ihnen, ob sie es wollen oder nicht, ein Geschlecht übergestülpt wird: In jeder Begegnung versucht das Gegenüber, ihnen eine von zwei Geschlechtsklassen zuzuweisen. Auch die (deutsche) Sprache erzwingt eine Geschlechtsbinarisierung, da sie gerade in zentralen Bereichen nur zwei Optionen (und nicht drei oder vier) vorsieht, so etwa bei der Anrede (Frau oder HerrHerr), in der Warteschlange (die DameDame/der HerrHerr war vor mir dran und kaum diese PersonPerson war vor mir dran), bei den Pronomen der 3. Person (sie oder er), bei der Namengebung (Michael oder Michaela). UnisexnamenUnisexnamen (Toni, Nicola) irritieren viele, führen zu Nachfragen und werden nur selten vergeben. Standesämter raten von ihnen ab.
Wir werden dieses Spektrum an geschlechtlicher Vielfalt mit in den Bick nehmen, ohne umgekehrt aus dem Blick zu verlieren, dass die große Mehrheit der Menschen der Zweigeschlechtlichkeit frönt und sich mehr oder wenig stark zu ihrem Geschlecht bekennt. Beim doing gender (Kap. 2) werden auch biologische Fakten ins Feld geführt: Stimmunterschiede werden dramatisiert, Bekleidungen gewählt, die deutlich auf die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale hinweisen bzw. diese exponieren, Operationen durchgeführt, die die biologischen Geschlechtsmerkmale bearbeiten, vergrößern, ‚optimieren‘, betonen, Bärte werden wachsen gelassen etc. Biologische Geschlechtsmerkmale werden somit (neben einer Palette an kulturellen Indices) mehr oder weniger bewusst zur Geschlechtsdarstellung eingesetzt – ein Blick ins Fernsehen, ins Internet oder auch nur ein Tritt vor die Tür reichen zur Bestätigung dessen aus. Biologische Sexus- und soziale Genderklasse korrelieren zu weit über 90 %, und dies wird von vielen affirmiert.
Daher differenzieren wir (entgegen radikalkonstruktivistischen Ansätzen von Judith Butler und anderen) zwischen Sexus und Gender, wohl wissend, dass Gender relevanter für die Geschlechtsdarstellung und -zuordnung ist und in keiner logischen Beziehung zum Sexus steht. Die Soziologie unterscheidet in diesem Sinn zwischen Weibchen und Männchen (Sexus) sowie zwischen Frauen und Männern (Gender) (Hirschauer 2013). Wir alle führen einen Körper mit uns, der für andere sichtbar ist und dem diese ein Geschlecht zuweisen (ein Faktum, das Butler vernachlässigt). Dies zeigt: Geschlecht ‚gehört‘ nicht nur dem Individuum, Geschlecht wird in aller Regel und binnen kürzester Zeit von außen zugewiesen. Gelingt die Geschlechtszuweisung nicht, führt dies (beiderseits) zu Irritationen. Dies erfahren Transgender-PersonenTransgender zu Beginn ihrer Transition, wenn sie Hormone einnehmen, ihre Kleidung verändern etc. Hier erweist sich das alltägliche Interesse an einer wohlgeformten GeschlechtergrenzeGeschlechtergrenze am offensichtlichsten: „Also uns sind Beschwerden über Sie zu Ohren gekommen. Sie sind geschlechtlich nicht eindeutig“, zitiert eine davon betroffene Trans-PersonTrans-Personen ihren Arbeitgeber (Schmidt-Jüngst 2018a, 66). Viele gehen im Alltag davon aus, dass jede Person genau ein festes Geschlecht hat. Jemanden nach ihrem/seinem Geschlecht zu fragen, bedeutet, es als solches zu bezweifeln. Die meisten Menschen würde diese Frage schockieren (sie wird auch kaum gestellt), selbst wenn sie an der Geschlechtsdarstellung (Gender) desinteressiert sind. Ab der Geburt wird das, was Geschlecht primär ausmacht, so schnell und intensiv verinnerlicht, ohne dass man sich (einschließlich vieler erschreckter Eltern, die behaupten, bei der Erziehung keinen Unterschied zu machen) dessen bewusst ist. Da wir uns im Folgenden nicht immer dazu äußern können und wollen, ob Sexus- und Genderklasse übereinstimmen, sprechen wir vereinfachend von Geschlecht, wenn wir die persönliche Geschlechtszugehörigkeit eines Menschen meinen.1 Umso konsequenter werden wir in der Grammatik das Wort Geschlecht meiden (wir sprechen dort nur von Genus).
In ihrem berühmten Werk „Das andere Geschlecht“ (1949) erklärte Simone de Beauvoir:
Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es [d.h.: dazu gemacht]. Keine biologische, psychische oder ökonomische Bestimmung legt die Gestalt fest, die der weibliche Mensch in der Gesellschaft annimmt. (Beauvoir 1992, 334).