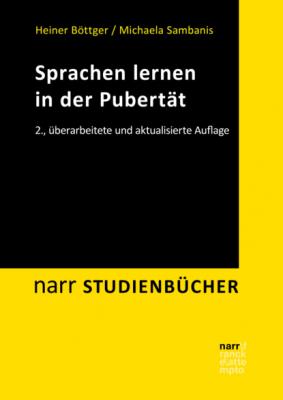ТОП просматриваемых книг сайта:
Sprachen lernen in der Pubertät. Heiner Böttger
Читать онлайн.Название Sprachen lernen in der Pubertät
Год выпуска 0
isbn 9783823302766
Автор произведения Heiner Böttger
Жанр Документальная литература
Серия narr studienbücher
Издательство Bookwire
2.2.2 Rituelle BeschimpfungRituelle Beschimpfung und KurzdeutschKurzdeutsch
In den Kontext von Provokationen und Erzeugung von Aufmerksamkeit fügt sich auch das schon seit mehreren Generationen in der einen oder anderen Form zu beobachtende Phänomen der rituellen BeschimpfungRituelle Beschimpfung ein.
Respekt, Anerkennung und Dominanz werden aggressiv eingefordert. […] Letztlich dient […] [die rituelle BeschimpfungRituelle Beschimpfung aber auch] dazu, sich gegenseitig Respekt zu bekunden. […] Rituelle Beschimpfungen stellen einen Gegenentwurf zu den gültigen Regeln der Höflichkeit in der Erwachsenenwelt dar, und letztlich geht es Jugendlichen genau um diese identitätsstiftende Abgrenzung. (Marossek 2016: 64, 65, 77)
Nicht alles, was in den Ohren von Erwachsenen wie eine Beschimpfung klingt, ist tatsächlich so gemeint.1 Offenbar kommt es – auch hier sind wieder Mittel jenseits der Wort- und Satzebene von Relevanz – sehr auf die Art an, wie die rituelle Beleidigung ausgesprochen wird. Manchmal soll allein die Länge eines einzelnen Vokals entscheidend dafür sein, ob z.B. Opferknecht tatsächlich beleidigend oder anerkennend gemeint ist (vgl. Marossek 2016: 71).2Rituelle Beschimpfung
Die rituelle BeschimpfungRituelle Beschimpfung ist, zusammenfassend betrachtet, ein sehr anschauliches, greifbares Merkmal des Kurzdeutschs. Diejenigen, die sie praktizieren, zeigen in der Regel auch eine besondere Affinität zu den anderen Eigenheiten des Kurzdeutschs und umgekehrt. (Marossek 2016: 77)
Hier wird von Marossek ein weiteres bemerkenswertes Phänomen erwähnt: das KurzdeutschKurzdeutsch. Largo/Czernin (2011: 113) weisen auf die Prägnanz von Jugendsprache und die Häufigkeit von Abkürzungen hin, was sich nicht auf die lexikalische Ebene beschränkt, sondern auch in syntaktischen Merkmalen niederschlägt. Die Tendenz zur Auslassung von Präpositionen und zur Tilgung von Artikeln sind Schlüsselmerkmale von Kurzdeutsch (Lassma Aldi gehen; Was? Gestern war ich Schule!). Bestimmte Ausprägungen von Jugendsprache bilden sozusagen die Keimzelle des Kurzdeutschs, inzwischen finden sich aber auch in der Sprache anderer Bevölkerungsgruppen Spuren von Kurzdeutsch, was ein konkretes Beispiel dafür ist – ob man es in diesem Fall nun schön findet oder nicht –, dass die sprachlichen Innovationen der jungen Generation die Grenzen des eigenen Soziolekts tatsächlich verlassen können. „Mit steigender Verbreitung unter den Erwachsenen verliert das Element oder gar der ganze Stil irgendwann endgültig den Status Jugendsprache und ist nun Bestandteil der ganz normalen Umgangssprache“ (Marossek 2016: 48).
Die Verbreitung von KurzdeutschKurzdeutsch sei vor allem auf Formate der Selbstinszenierung im Internet, wie Posts in sozialen Netzwerken und Filme bei YouTube, zurückzuführen (vgl. Marossek 2016: 80f.). Auf diese Weise habe die Jugendkultur, gemeint ist in diesem Fall vor allem die multikulturelle Jugendkultur, denn diese soll maßgeblich an der Ausprägung von Kurzdeutsch beteiligt sein, selbst dazu beigetragen, dass Merkmale ihrer Jugendsprache Einzug in die Umgangssprache gefunden haben.
Jugendsprachen zeigen vielfach Einflüsse von fremden Sprachen, z.B. des Türkischen oder Arabischen sowie weiterhin des Englischen, von Netzjargon und vereinzelt aus der Musik, z.B. soll Babo, das Jugendwort 2013, durch ein Lied des deutsch-kurdischen Rappers Haftbefehl Verbreitung gefunden und Deichkind der Jugendsprache im Jahr 2012 „leider geil“ beschert haben.
Die Merkmale jugendsprachlicher Narrationen, einer bedeutenden Form jugendsprachlicher InteraktionInteraktion, lassen sich auf folgende vier Punkte verdichten:
„Selbst- und fremdbezogene Befindlichkeiten werden sehr spontan und empathisch mitgeteilt durch Interjektionen […], [a]ufmerksamkeitsfordernde Partikel[ ] wie ey, alter […] prosodisch inszenierte direkte Rede, Intensivierer ([…] krass u.a.)“ (Steckbauer 2014: 155).
„Grammatische Korrektheit wird vernachlässigt“ (ebd.).
„Sondervokabular: […] abziehen („jmd berauben“), standard […]“ (ebd.).
Einsatz sogenannter Attention Getters, „multifunktionaler und -kategorialer, höchst frequenter Gebrauch des verbalen Joker so“: Die „Einleitung der „direkten Rede“ durch so ist besonders jugendsprachlich“ (Steckbauer 2014: 156).
2.2.3 Parasoziale InteraktionenParasoziale Interaktionen
Das auf Horton/Wohl (1956; vgl. Spreckels 2014) zurückgehende Konzept der parasozialen InteraktionParasoziale Interaktionen ist für die Betrachtung von Kommunikation im Jugendalter und Jugendsprachen insbesondere im Hinblick auf kommunikatives Verhalten in Verbindung mit MedienrezeptionMedien, -rezeption, -nutzung von Bedeutung. Als parasozial werden InteraktionenInteraktion bezeichnet, „die einseitig und nicht reziprok sind“ (Spreckels 2014: 168), also z.B. dann stattfinden, wenn Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer „TV-Akteurinnen direkt ansprechen […], diese aber natürlich nicht darauf reagieren“ (ebd.). Mit Freundinnen und Freunden eine Sendung zu schauen, dabei das Geschehen auf dem Bildschirm zu kommentieren und als Anlass für sprachliche Interaktion zu nutzen, stellt ein in der Alltagswelt etabliertes Phänomen dar, wobei es sich zwar um eine „asymmetrische Interaktionsform handelt“, aber dennoch um „aktives (soziales) Handeln seitens der Rezipienten“ (Spreckels 2014: 169). In der Alltagsgestaltung Jugendlicher spielt das Fernsehen „weiterhin eine zentrale Rolle“ (mpfs 2015: 11).1 Die TV-Nutzung beträgt bei Jugendlichen an Werktagen etwa 107 Minuten (mpfs 2019: 34) und einen Fernseher gebe es bei 96 Prozent (vgl. ebd.: 52). Wobei übrigens Sitcoms und Comedy ganz oben auf der Beliebtheitsskala stehen (vgl. mpfs 2015: 24f.; 2019: 36). In vielen Fällen befassen sich Jugendliche beim Fernsehschauen zeitgleich mit anderem, nämlich mit ihrem Smartphone (59 %, vgl. mpfs 2015: 27) oder sie machen Hausaufgaben (knapp ein Fünftel der Befragten, vgl. mpfs 2015: 27f.), was wegen der Unteilbarkeit der AufmerksamkeitAufmerksamkeit (vgl. 3.1) wohl die Qualität mancher Hausaufgaben erklärt. Außerdem werden Sendungen als Kommunikationsauslöser genutzt und „41 Prozent sehen regelmäßig fremdsprachige Videos“ (mpfs 2019: 39).
Spreckels hat über einen Zeitraum von circa zwei Jahren Sprachdaten von fünf befreundeten fünfzehn- bzw. sechszehnjährigen Mädchen aufgezeichnet und ausgewählte Sequenzen analysiert (teilnehmende Beobachtung, Auswertung ethnographisch, gesprächsanalytisch, vgl. Spreckels 2014: 165).2 Die Daten basieren auf Audioaufnahmen von Gesprächen der Freundinnen bei unterschiedlichen Freizeitaktivitäten, darunter auch das gemeinsame Schauen von TV-Castingshows. In diesen Fällen handelt es sich bei den Gesprächsdaten um aus parasozialen InteraktionenParasoziale Interaktionen gewonnene Daten. Gemeinschaftlicher Medienkonsum führt oft zu „medial ausgelöste[n] Kommunikationsereignisse[n]“ (Spreckels 2014: 180), bei denen Prozesse der Vergemeinschaftung der Zuschauerinnen und Zuschauer vonstattengehen: „Die Analyse der parasozialen InteraktionenInteraktion hat gezeigt, dass die Mädchen den Mediendiskurs nutzen, um geteilte Werte und Normen […] zum Ausdruck zu bringen“ (Spreckels 2014: 180). Häufig werde bewertet, was auf dem Bildschirm zu sehen sei, auch Lästersequenzen seien keine Seltenheit, was auf das „Fehlen der Reziprozität“ (Spreckels 2014: 181) der Kommunikation zurückgeführt wird, wodurch die oder der Beurteilende im sicheren Raum agiert, keine Gegenrede oder sonstige Retoure des Beurteilten befürchten muss. Es wird angenommen, dass junge Menschen auf diese Weise ihre kommunikativen Fertigkeiten und insbesondere ihre Schlagfertigkeit im geschützten Feld der Mediendiskussion trainieren.
Mediendiskurse fallen, besonders bei Jugendlichen, oft humorvoll, parodistisch und ironisch aus (Spreckels 2014: 183), sie aktivieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die damit die Rolle des rezeptiven und eher passiven Publikums verlassen. Mediendiskurse werden in der Regel